Der Gral ist gefunden!
Nach vier Jahren intensiver Suche habe
ich nun endlich den Reitersitz der alten akademischen Reitkunst
gefunden: s. Update 15. Mai 2020
Neu: Zusammenfassung meiner wichtigsten Forschungsergebnisse seit 2016 auf https://schimmerwald.de/page24.html
Forschungsobjekt Guériniére-Sitz: Blog seit Mitte 2016 bis heute
Seit März 2016 wende ich den Sitz nach Guérinière etwas abgewandelt an und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei diesem Reitersitz sollen die Reiterbeine nach vorn gehalten werden, "vor dem Pferd", und diesen Platz fast immer beibehalten.
Das Kinn soll hoch getragen und die Brustwirbelsäule etwas nach vorn geschoben werden, die Schulterblätter sollen etwas abwärts wandern, ohne sie hinten zu sehr zusammenzuziehen; in etwa wie bei einem 100m Läufer, der als erster das Zielband durchreißen möchte.Guérinières Grundhaltung besteht weiterhin aus einer über dem Widerrist aufrecht stehenden Faust, in der die Zügel einhändig links geführt werden, Zäumung auf blanke Kandare, oberer Zügel zwischen 4.und 5. Finger, unterer Zügel um den Kleinfinger herum.
Der Daumen der Zügelfaust ist oben, der kleine Finger unten. Die Faust steht um 10-15° nach links gekippt (10° supiniert). Diese fast senkrechte Haltung wird im Grundsitz geradeaus in der Regel nur äußerst minimal verändert.
Gelegentlich muss der rechte Zügel aber mit der rechten Hand gegriffen werden, dafür wird dann die Gertenhand eine Fausthöhe tiefer als die Zügelhand gestellt (Nachtrag 2018: dies gilt nur bei Verwendung einer Trensenkandare)( Nachtrag 3.11.19: siehe hierzu Update 29.10.19!); ansonsten steht die Gertenhand auf gleicher Höhe wie die Zügelhand und nahe bei dieser.
Um mein Gleichgewicht in dieser Haltung zu trainieren, wende ich sie häufig an, auch ohne die Zügel getrennt zu führen. Guérinière hebt zum Versammeln die Zügelfaust und senkt sie wieder zum Zulegen.Meine Abwandlung besteht darin, dass ich zum Zulegen das PIP-Gelenk (Gelenk zwischen dem Grund- und dem Mittelglied) des Zügelfaustkleinfingers nach vorne schiebe und damit die senkrecht stehende Faust so kippe, dass der untere Teil nach vorne zeigt (als wolle man mit einer senkrecht in der Zügelfaust getragenen Gerte sich selbst in der Mitte seiner Stirn touchieren): im Extremfall kann der Reiter die Fingerrücken der Grundglieder der Finger zwei bis vier sehen. So entsteht eine radiale Abknickung des Handgelenks (= zum Radius (dt.: Speiche) hin). Diese Bewegung des Handgelenks gleicht der Bewegung der unteren Hand am Stechpaddel in einem Kanadier beim Rückwärtspaddeln: die resultierende Reiterückenspannung ebenso. Es entsteht eine starkes Spannungsgefühl über (radial) und unter (ulnar) dem Handgelenk bis in die Mitte des Unterarmes hinein.Als Bezeichnung für diese Bewegung schlage ich den Namen "Pinky-Push" vor (Pinky = engl. für "Kleinfinger").
Zum Versammeln dagegen ziehe ich den Kleinfinger nach hinten Richtung Reiterbauch, damit wird die Faust so gekippt, dass im Extremfall für den Reiter der Daumennagel nicht mehr sichtbar ist (als wollte man mit einer senkrecht in der Zügelfaust getragenen Gerte das Pferd mitten zwischen den Ohren touchieren). Hier entsteht eine ulnare Abknickung des Handgelenks (zur Ulna, dt.: Elle) hin. Für diese Bewegung schlage ich den Namen "Pinky-Pull" vor. In beiden Fällen bleibt der Daumen in derselben Lage wie vorher.
Die rechte Hand wird auf den meisten seiner Bilder in Supination gehalten (Supination ist die Haltung der Handfläche nach oben (Gedächtniskrücke: "als wolle man Suppe aus der Hand essen"); das Gegenteil, Handrücken nach oben, bezeichnet man als Pronation. Nicht nur mit dem Vorschieben des Kleinfingers der Zügelhand, sondern auch mit dem der Gertenhand kann man das Zulegen unterstützen = Pinky-Push der Gertenhand (diese muss dafür aber die Supination aufgeben und sich aufrecht in Neutralstellung begeben).
Erst die Supination der Hände gibt dem Reiterbauch den Raum, nach vorn zu kommen (pronierte Hände dagegen verhindern das!): ich nenne das "den Bauch vor dem Pferd". Diese Haltung ist die Voraussetzung für den Pinky-Push.

Das Zulegen erfolgt erstaunlich spontan: schon während des Pinky-Pushes, als nehme man den Druck von einer Stahlfeder! Das Versammeln durch den Pinky-Pull hingegen erfolgt so sanft, dass ich immer zwei bis drei Schritte/Tritte brauche, um es zu registrieren.
Forschungsteil A wäre die Bestätigung folgender Thesen durch andere Reiter:
1. Das Zulegen durch den Pinky-Push (= Vorschieben des Kleinfinger-PIP Gelenks der Zügelhand) kommt nicht durch die winzige Gewichtsverschiebung des kleinen Teils der Faust Richtung Vorhand zustande, sondern durch die enstehende Muskelspannung im Reiterrücken, die den Reiterbauch nach vorn kommen läßt und deshalb das Reiterbecken minimal nach vorn kippt.
2. Das Versammeln durch den Pinky-Pull kommt ebenso hauptsächlich dadurch zustande, dass der Reiterbauch beim Zurückführen des Kleinfingers eingezogen wird und dadurch das Reiterbecken zum Nachhintenkippen kommt.
3. Die Supinationshaltung der Gertenhand hebt die Blockierung des rechten Schultergelenks auf, dieses kommt etwas nach hinten und fühlt sich freier an. Der rechte Oberarm legt sich an den Brustkorb des Reiters, der jetzt ausgewogener sitzt.
4. Drückt man bei nach vorn genommenen Beinen die Vorfüße in den Steigbügel, kommen die Fersen etwas hoch und die Oberschenkelmuskeln entfernen sich vom Brustkorb des Pferdes, dies führt zu einer größeren Rotationsfreiheit des Pferdebrustkorbes beim Versammeln (nicht zu verwechseln mit dem einfachen Hochziehen der Fersen!).
Forschungsteil B wäre dann bei Bestätigung einer oder mehrerer meiner Thesen in A der Versuch, dazu passende Muskelbewegungsketten beim Reiter darzustellen (dazu könnten auch Orthopäden, Physiotherapeuten und Osteopathen etwas beitragen): denkbar wäre z.B.: „Der Pinky-Push (das radiale Kippen der Zügelfaust) zum Zulegen führt über ein Anspannen der radialen Handabduktoren zu einer Anspannung des Muskulus triceps brachii, das wiederum zu einem Abkippen des unteren Schulterblattes mit Druck auf die Rippen, was wiederum zu einer steileren Stellung der BWS führt und dies wiederum zu einer verstärkten LWS-Lordose, die das Reiterbecken nach vorn abkippen läßt. Das alles mit Bennung der einzelnen Muskeln und deren Bewegungen, ggf. auch deren Gegenspielern.
Oder vielleicht für die Pronation der Gertenhand: „Die Blockierung der rechten Reiterschulter bei pronierter Gertenhand resultiert aus der Anspannung des Muskels X, die zum Festhalten des gleichseitigen Schultergelenks und reflektorisch über eine Anspannung des langen Rückenmuskels zu einem Heben des Beckens linkssseitig durch den Muskel Z und damit zu einem Verschieben des Reiterkörpers oberhalb seines Beckens nach rechts führt.“
Wenn genügend Reiter Teil A überprüft haben, würde ich gern eine Diskussionplattform o.ä. aufbauen für alle, die an Teil B mitwirken werden.
Dr. Daniel Ahlwes, Schimmerwald, Juli 2016
P.S.:Vorsicht: wenn man die Beine nach vorn hält, darf man dort vorn die Sporen nicht einsetzen: man trifft dabei häufig den ungeschützten Ellenbogenknochen des Pferdes, trotz stumpfer, abgerundeter Sporen sehr schmerzhaft!).
Gründe für den Guérinière Grundsitz:
Ich stimme der Meinung zu, dass eine Kandarenzäumiung von beträchtlichem Nutzen ist. Des weiteren halte ich die einhändige Zügelführung in den meisten Situationen für überlegen (die beidhändige verwende ich bei blanker Kandare nur in ausgesuchten Ausnahmesituationen).
Wenn man bei der einhändigen Zügelführung nicht nur mit einem dominanten Zügel arbeiten möchte, der nur an einer Seite des Pferdehalses anliegt (wie z.B. beim Marc Aurel-Denkmal), sondern beide Zügel mit mehr oder weniger gleichem Druck auf die Haut des Pferdehalses einwirken lassen möchte, ist damit die Zügelfausthaltung in der Mitte vorgegeben: bei Guérinière im gebogenen oder geraden Geradeaus senkrecht mittig über dem Widerrist, [Korrektur 2020: NICHT wie ich dachte, mit nach vorne zeigendem Daumen, der parallel zum Widerristverlauf steht, sondern mit einem Daumen der ca. 30-50° seitwärts zur Gertenseite weist!].
Da die Mitte über dem Widerrist von der Zügelhand besetzt ist, muss man damit leben, dass es hierbei keine Symmetrie des Reiteroberkörpers geben kann, und versuchen, einen entsprechenden Ausgleich zu finden um das Reitergleichgewicht irgendwie wiederherzustellen.
Die Haltung der Zügelfaust (senkrecht stehend mir geringer Kippung der Faust nach links) stellt eine beginnende Supination auch der linken Hand dar: diese führt dazu, dass der linke Oberarm an den Brustkorb geführt wird und relativ stabil in dieser Lage gehalten wird.Die Supination der Gertenhand führt als Ausgleich nun nicht nur dazu, dass die rechte, blockierte Schulter frei wird, es legt sich dabei auch der rechtsseitige Bizepsmuskel mehr an den Brustkorb des Reiters an und gleicht damit die Oberarmhaltung der linken Seite aus.Zum Abwenden kippt man die Zügelfaust so, dass der (wie immer nach vorn zeigende) Daumen nach aussen wandert, bei feststehender Basis der Zügelfaust, und löst damit eine winzige Druckdifferenz des Zügeldrucks am Pferdehals aus, die eine prompte und punktgenau steuerbare Wendung des Pferdes hervorruft. Zur Unterstützung der Rechtsbiegung legt Guérinière die Gerte, supiniert gehalten, quer über Zügel und Hals nach links. Beim Linksbiegen hält man in Supination die Gerte in einigem Abstand rechts parallel zum Pferdehals. Möchte man hierbei nicht versammeln, muss man darauf achten den Pinky-Push anzuwenden (also den Kleinfinger deutlich vorzuschieben).
Mein Plan zum weiteren Selbstunterricht (unter gelegentlicher, regelmäßiger Supervision mit hochkarätiger Hilfe zur Selbsthilfe durch den MdAR Marius Schneider), ist es, zunächst für einige weitere Monate den Guérinière Grundsitz einzuüben, mit dem Ziel, in jeder Reiteinheit wenigstens ein Drittel der Zeit in einer guten Annäherung an diesen Sitz zu reiten. Erst danach werde ich versuchen, den viel komplizierteren erweiterten Sitz nach Guérinière zu trainieren:
Guérinière zeigt nämlich auf vielen Bildern ein zusätzliches Merkmal: er benutzt gelegnetlich den kleinen Finger der Gertenhand, um in den rechten Zügel zu greifen: so reitet er dann aber in Wirklichkeit mit getrennten Kandarenzügeln. Er benutzte allerdings am liebsten eine "simple canon": eine Kandare mit einfach gebrochenem Mundstück. Er stellt dabei die Gertenhand eine Fausthöhe tiefer als die linke, sie bleibt in Supination, nimmt nur noch „nebenbei“ den kleinen Finger für den nun viel tiefer verlaufenden rechten Zügel hinzu. Ist seine Grundhaltung schon ziemlich anspruchsvoll, erreicht der Reiter hier schon eine kleine Meisterschaft, wenn er dies korrekt ausführen kann! Als intermediäre Zügelführung kann man den kleinen Finger der Zügelhand in Richtung Gertenseite ausstrecken und damit den Zügel etwas abstoßen, um die gertenseitige Biegung unterstützen.
Update August 2016:
Inzwischen sehe ich den Guérinière Grundsitz als sehr verlässliches Fundament meines Sitzes an, dessen wichtigste Stützpfeiler meine fast immer nach vorne gehaltenen Beine plus die fast immer aufrecht, ca. 10% supiniert gehaltene Zügelhand und die 30-90° supinierte Gertenhand sind (die aufrecht stehende Faust als Basis wird hier mit 0° bezeichnet, von der aus 90° Supination in die eine und 110° Pronation in die andere Richtung möglich ist).
Gelegentlich noch notwendige große Bewegungen der Gertenhand können an diesen stabilen Elementen sehr gezielt angelehnt werden.
Die meisten Reiter werden frustrane Erlebnisse mit der Nicht-Reproduzierbarkeit bestimmter Hilfengebungen kennen: führt man z.B. den Gertenoberarm an den Oberkörper, kann es sein, dass man damit ein weiches, promptes Kruppheraus zur Gegenseite auslöst. Wenn das fünfmal gut geklappt hatte, freute man sich unbändig, eine neue schöne Hilfengebung gefunden zu haben. Leider klappte es dann plötzlich für Monate nicht mehr oder kaum noch!
Die Ursache sehe ich nun, zumindest zu einem großen Teil, darin, dass das Anlegen des Oberarmes an den Brustkorb in Pronationsstellung der Hand einen ganz anderen, oft sogar gegenteiligen Einfluss hat als in Supinationsstellung der Hand! Deshalb achte ich jetzt sehr auf diese Rotation der Unterarme: so wird der Hieb meiner Gerte, mit der ich als Blankwaffenersatz Brombeerranken, Distelköpfe usw. attackiere, sehr viel sicherer und weicher in Supination (entsprechend dem Vorhandschlag beim Tennis und beim Polo: hierbei kommt allerdings zusätzlich eine beträchtliche Aussenrotationsfähigkeit im Schultergelenk ins Spiel!).
Auch das Touchieren der Kruppe/Hinterhand auf beiden Seiten versuche ich nun immer in Supination der Gertenhand auszuführen; wenn ich z.B dazu (zur gebogenen Seite) die Gertenhand vorn um meinen Bauch herum nach hinten führe, geht das nur so, denn in Pronation würde sich meine Wirbelsäule deutlich verwerfen und Takt und Bewegung des Pferdes schwer stören.
Diese starke Drehung des Oberkörpers nutze ich auch gern als Gymnastizierung meiner rechten Schulter, die hierdurch freier wird und viel mehr nach vorn kommen kann (und als Vorbereitung für einen Werkzeuggebrauch auf der "falschen" Seite!). Man muss natürlich aufpassen, das dabei die Zügelhand ihren Platz über dem Widerrist nicht verlässt, was ein wenig anspruchsvoll ist!
Die letzten drei Sätze zeigen, dass ich auch noch die Gebrauchsreiterei im Auge habe: Der Guérinière Sitz hingegen ist ja reine "L'Art pour l'art" (Kunst nur für die Kunst). Hier wäre das schönste Kompliment vielleicht, wenn Baron von Eisenberg (1748) meinen Reitstil wie den des Rittmeisters von Regenthal bewunderte:" Ich habe niemals einen Reiter gesehen, der steiffer zu Pferde gesessen wäre oder der die Vortheile sonderheitlich der Beine besser gewusst hätte als er! Es war eine rechte Freude anzusehen..!" (Im Kommentar zu Tafel 37, hier auf Seite 76).
Update 2:
Gueriniere durfte sich allerdings nicht so weit von der Gebrauchsreiterei entfernen, dass er auf den Rechtshändersitz verzichten konnte/wollte. Wir sind heute freier als er und lassen auch den Linkshändersitz, mit Vertauschen der Gerten- bzw. Zügelhand, zu.
So kann ich der Schwierigkeit, den kleinen Finger in den rechten Zügel einzuhaken (und damit dem Reiten mit getrennten Zügeln) manchmal aus dem Weg gehen, indem ich zeitweise die Zügel in die rechte Hand wechsele. Im Linkshändersitz kann nun der rechte Kleinfinger die größere Bewegungsfreiheit nutzen um das Pferd im Hals schonender zu stellen; ausserdem ist nun die Gerte zum Verstärken der Rechtsstellung nicht mehr nur eingeschränkt quer über den Hals des Pferdes, sondern voll parallel links des Pferdehalses einsetzbar.
Das bedeutet bei Zulassen des Wechsels in den Linkshändersitz bei Bedarf, dass die Gerte nun bei Bedarf auf beiden Händen aussen getragen werden kann!
Update 15. September 2016:
Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass für das einhändige Reiten dieser Sitz der neue Referenzsitz in der akademischen Reitweise werden wird, an dem sich alle anderen werden messen lassen müssen. Grobere, unpräzisere Hilfen entfallen ganz, viele Hilfen werden unsichtbar und das Pferd geht sehr viel freier und ungezwungener: die Anmut des Pferdes bleibt erhalten.
Durch den festgelegten Grundsitz kommt der Anfänger viel schneller vorwärts und der Fortgeschrittene kann an diese feste Struktur wunderbar Neuerungen/Änderungen anlehnen und deren Auswirkungen genauestens evaluieren.
Vielleicht werden wir schon bald an die Exzellenz eines Barons von Eisenberg oder Guerinieres herankommen und so auch schöne Schulen über der Erde viel mehr Reitern ermöglichen?
Update 26.Sept.:
Mit dem Pinky-Push (dem Vorschieben des Kleinfingers der Zügelfaust) wird das Vorschicken des Pferdes (in Kombination mit bedarfsweiser Unterstützung durch die Gerte) so einfach, dass die Reiterbeine sich für immer längere Zeiträume und immer weiter vom Pferdebauch entfernen können und mit der Zeit sogar eine Drehung der Fersen vom Pferd weg langandauernd möglich ist. Das führt zum Wegdrehen des Wadenmuskels und zu einem noch freieren Gang des Pferdes (ein Hindrehen des Wadenmuskels zum Pferd innen findet nur noch kurzzeitig und bedarfsweise statt).
Das zusätzliche leichte Hochziehen der Fersen führt zu einer Versteifung von Sprung- und Kniegelenken des Reiters und aus dieser resultiert ein dauernd gleichbleibender Abstand von Fußballen zu Gesäß (ein wenig „steht der Reiter in den Bügeln“, vergleichbar einem „Sitz“ auf einem Stehhocker).
Dadurch wird ein Plumpsen in den Sattel verhindert und beim Traben oder Galoppieren entsteht ein immer gleicher angenehmer Sitzdruck im Sattel, ganz unabhängig von steifen Gängen des Pferdes oder evtl. steilstehenden Fesselgelenken. Es kommt zu keinem „Auswischen“ des Sattels mehr und der Reiter sitzt immer an derselben Stelle im/auf dem Sattel. Die Federung des Reiters findet nun gleichmäßig in allen seinen minimal nachgebenden Hüft-, Knie- und Sprunggelenken statt.
Update 28.Sept. 2016:
Inzwischen wird die Gleichartigkeit des Gueriniere-Sitzes, mit supinierten Händen, mit dem Lotossitz im Yoga klar: Der Lotossitz erzeugt die bestmögliche Haltung der menschlichen Wirbelsäule auch für extrem langes Sitzen: Die (hierbei fast maximale) Supination der Hände führt zu einem Zurückführen der Schultern, einem Öffnen des Brustkorbes nach vorn und hierdurch einer physiologischen Stellung der Brustwirbelsäule (der Kyphose). Die nun richtig stehende LWS (Lordose) und BWS (Kyphose) ermöglicht jetzt auch der Halswirbelsäule das Einnehmen der besten Stellung (Lordose) und konsekutiv dem Kopf eine ermüdungsfreie Haltung mit erhobenem Kinn.
Die bisher überwiegende Pronation der Hände führte dagegen zu einer Einengung des Brustkorbes durch die nach vorn wandernden Schultern: Es entstand ein unphysiologischer "Buckel" (Hyperkyphose) in meiner BWS, die auch als falscher Knick bezeichnet werden kann, der genauso wie der falsche Knick in der Pferde-HWS an dieser Stelle einen Stopp für die Schwingungen in der Reiterwirbelsäule bewirkt. Kein Wunder, dass mein Kopf zu häufig nach unten kam: er hatte ja kaum Unterstützung bei dieser schlecht stehenden BWS und HWS!
Diese Haltung ergab ein Nachvornfallen des Oberkörpers und konsekutiv eine Belastung der Vorhand. Zusätzlich führte diese WS-Haltung zu einem Abkippen meines Beckens nach hinten, die Hilfe für ein Versammeln: deshalb trat das Pferd häufig hinten kürzer, während es auf der Vorhand lief.
Der Guerinieresitz bewirkt das Gegenteil: durch die aufrecht stehende, minmal supinierte Zügelfaust und die meist stärkere Supination der Gertenhand werden die Schultern zurückgeführt, der Brustkorb öffnet sich nach vorn, die BWS und LWS richten sich auf und die HWS wird ebenso physiologisch gestellt: Man kann den Kopf ermüdungsfrei aufrecht tragen. Die Abkippung des Beckens kommt in eine neutrale, aufrechte Lage, weder versammelnd nach hinten, noch zulegend nach vorn gekippt.
Update 19.10.16:
Endlich geht es in großen Schritten voran: nach vielen Jahren mühsamen Rumdümpelns auf der Vorhand gibt es nun in jeder Woche einen deutlichen Fortschritt: war Paco früher „stätig“(= sich zurückhaltend) und sehr „triebig“ (musste dauernd sehr stark getrieben werden), was zu einem dauernd klopfendem Schenkel führte, gehen er und Picasso heute meist sehr viel leichter und in einem frischen Tempo, ein gelegentliches leichtes Treiben mit der Gerte genügt, wenn der Pinky-Push nicht ausreichen sollte. (Picasso hatte ja durch diesen zurückhaltenden Sitz sogar die Angewohnheit, beim Angaloppieren im Terre-a-Terre zu beginnen und sich dann von mir in einen ordentlichen Feldgalopp schieben zu lassen!).
Alles bisher Gelernte lässt sich nun wunderbar integrieren, und, auch für mich noch unglaublich: ich kann Paco jetzt im Fellsattel ohne Bügel und Zügel, nur mit Gertenlenkung und supinierten Händen in der Halle ganze Bahn und auf dem Zirkel ruhig und gleichmäßig galoppieren, freihändig also! Ohne mit den zur Seite komplett weg gehaltenen Beinen in irgendeiner Weise zu klemmen, nur auf meine Sitzbeinen Kontakt mit dem Pferderücken zu haben, in völlig ausbalanciertem Gleichgewicht: ein wunderbares Gefühl!
Seit 10 Tagen reite ich ohne Sporen (zum ersten Mal nach 10 Jahren!) und merke erst jetzt, welchen negativen Einfluss ihr Einsatz auf den Takt und die fließende Bewegung des Pferdes hatte.
Zum Testen der Anleitung Eisenbergs zum Erzielen des Schulterhereins habe ich jetzt wieder den Kappzaum zur Kandare dazugenommen. Eisenberg zieht den inneren Kappzaumzügel an (bei losen Kandarenzügeln) und bringt damit den Kopf nach innen, dann schiebt er diese Hand auf die äußere Seite des Widerrists (erzeugt so einen um sich herum biegenden Zügel). Bei Bedarf nutzt er den äußeren Kappzaumzügel als von sich wegschiebenden Zügel (den Hals und die Schulter des Pferdes nach innen schiebend) wenn die Sitzhilfe allein nicht ausreicht. Mit supinierten Händen geht das alles verblüffend leicht und wunderbar präzise!
Bei 3:1 bzw. 1:3 Zügelführung ergibt sich dann das Problem, dass man sich entscheiden muss, was man mit der Gertenhand tun möchte: entweder die Gerte parallel zum Hals einsetzen (führt zum Lockerlassen des Gertenhandzügels) oder diesen Zügel benutzen (dann ist die Gerte nicht voll einsetzbar).
Dieses Problem umgeht man mit 4:0 bzw. 0:4 Zügelführung: auch hierbei kann man o.g. Schulterhereinmanöver zuverlässig ausführen und hat dabei eine volle Einsatzfähigkeit der Gerte.
Zum Geraderichten beim Geradeausreiten im Gelände eine wunderbar hilfreiche Lektion!
25.10.16. Entdeckung des Tages: Pinky-Push Blockaden gefunden:
Bei der Zügelführung 3:1 oder 1:3 wird bisher empfohlen, den einzelnen Zügel der Gertenhand zwischen dem 4. und dem 5. Finger zu führen. Jetzt ist mir aufgefallen, dass dies ein Zurückziehen des Bauches bewirkt, genau das Gegenteil der Pinky-Push-Wirkung! Möchte man dies vermeiden, muss man auch auf der Gertenseite den Zügel um den 5. Finger laufen lassen, denn dann passiert das nicht! (Ich hatte mir schon länger Gedanken gemacht, warum beim Englischreiten (mit der dabei meist üblichen aufrechten Haltung der Zügelfäuste wie bei der Grundstellung des Guerinieresitzes) der Pinky Push nie gefunden wurde: nun haben wir die Antwort darauf!).
Auch der Pinky-Push der Zügelhand wird mit 3 Zügeln schwieriger, weil er seine volle Wirkung nur entfaltet, wenn man auch den 4. Finger bewusst nach vorn mitschiebt.
26.10.16: Zwei weitere Pinky-Push Blockaden entdeckt:
Fasst man die Gerte (Fleck Dressurgerte) so, wie ich es bisher gewohnt war, indem man die untere Olive in der Faust hält, wird der Pinky-Push stark behindert: man muss die Hand also etwas höher zwischen den beiden Holzoliven am dünnen Schaft positionieren.
Ausserdem darf man den Daumen nicht aufrecht gegen den Gertenschaft drücken: das schadet genauso; man darf den Daumen nur auf den Kappzaumzügel legen!
Resultat: Die Gertenhaltung wird etwas schwammiger (man hält den Gertenschaft wie einen Blumenstrauß), dafür ist nun das Zulegen durch den Pinky-Push der Gertenhand seitengleicher und effektiver (die Gerte kommt nun allerdings dabei der Mitte der Reiterstirn etwas näher!).
31.11.2016: Tipps für Mitforscher:
Pinky-Push und Pinky-Pull: biomechanische Zusammenhänge
Wer mithelfen möchte, die Zusammenhänge (z.B. mit der kostenlosen Iphone-App „Muskelapparat 3D Lite“) zu untersuchen, ist gut beraten, folgende Begriffe zu kennen:
Abduktion: Bewegung weg vom Körper(-zentrum):wie in: abspreizen,
Adduktion: Bewegung hin zum Körper(-zentrum):wie in: Adverb,
Flexion: Biegung,
Extension:Streckung,
antero- : nach vorn,
retro-: nach hinten,
carpi: der Hand zugehörig.
Für das Verstehen der möglichen Bewegungen in der Erläuterung zu den Muskeln in der iPhone App muss man wissen, worauf sich „weg von“ und „hin zu“ sowie „Abduktion“ / „Adduktion“ beziehen und dazu braucht man das Verständnis der Neutral-Null-Methode.
Die Neutral-Null-Methode wird international benutzt, um Einschränkungen der Beweglichkeit zu dokumentieren, und diese in Grad-Zahlen eindeutig zu beschreiben: der Name bezieht sich auf die festgelegte Referenzstellung aller menschlichen Gelenke, die den Wert Null zugeschrieben bekommt.
Jede Abweichung wird in plus- oder minus-Gradzahlenwerten angegeben. Schaut man sich das Bild auf Wikipedia an, sieht man, dass die Hände hierbei in maximaler Supination dargestellt sind, obwohl sie ja eigentlich in Ruhestellung „an der Hosennaht“ liegen würden. Diese abweichende NN-Referenzstellung ist notwendig, damit man dem Handgelenk eine Abduktion und eine Adduktion zuweisen kann.
https://de.wikipedia.org/wiki/Neutral-Null-Methode
(Für die aufrecht stehende Faust im Gueriniere-Sitz wäre also -90° Supination die korrekte NN-Beschreibung).
Für uns ist es allerdings besser, die Guerinieresitz-Grundstellung (aufrecht stehende Faust) als Basis (0°) bezeichnen, von der aus eine Pronation von 1° bis 90° und zur anderen Seite eine Supination von 1° bis 90° möglich sind (damit entfält eine minus-Gradangabe).
Beispiel 1, einhändige Zügelführung links: beim geraden Geradeausreiten ohne Zulegen (Reiterbecken in Mittelpositur) wird die (linke) Zügelfaust in 10°Supination gehalten, die (rechte) Gertenfaust z.B. in 50° Supination.
Beispiel 2, einhändige Zügelführung links: zum Zulegen beim geraden Geradeausreiten mit Pinky Push (Reiterbecken nach vorn gekippt) werden beide Hände in 0° gehalten.
Beispiel 3, einhändige Zügelführung links: zum Abwenden nach links wird die Zügelfaust für wenige Sekunden in eine Pronation von 80° gebracht.
Zur Zeit vermute ich folgende Zusammenhänge: der Pinky-Push wird eingeleitet durch ein radiales Anwinkeln im Handgelenk (Abduktion des Handgelenks) durch Anspannen des radialen Handbeugemuskels sowie des radialen Handstreckmuskels. (musculus flexor carpi radialis und musculus extensor carpi radialis).
Die von uns angestrebte wirkungsvolle massive Ausführung wird erreicht durch ein starkes Anspannen der Gegenspieler: des ulnaren Handbeugemuskels und des ulnaren Handstreckmuskels (musculus flexor carpi ulnaris und musculus extensor carpi ulnaris).
Dadurch spannt sich reflektorisch der lange Kopf des m. triceps brachii an, der wiederum die Unterkante des Schulterblattes nach vorne unten zieht, was die Rippen und damit die Brustwirbelsäule nach vorn drückt.
Dieses löst eine Abflachung der BWS-Biegung (Hypokyphose) aus, was wiederum zu einem Vorschieben der Lendenwirbelsäule und deren Überbiegung (Hyperlordose) führt. Diese Bewegung nun kippt das Reiterbecken weit nach vorn und bewirkt damit das Zulegen des Pferdes.
(Inwieweit hier auch der m. subscapularis mithilft, ist unklar, ebenso wie die Mitwirkung der anderen Oberarm-/Schulterblattmuskeln).
Der Pinky-Pull, die Gegenbewegung mit Zurückführen des Kleinfingers zum Einleiten der Versammlung führt dann über das Einziehen des Bauches durch Streckung der LWS zum Zurückkippen des Reiterbeckens. Er ist vermutlich deshalb etwas schwächer, weil das Nachlassen des Schulterblattdrucks geringer wirkt als das Eindrücken in die Rippen beim Pinky-Push.
Update 4.11.2016:
Unter den Reitkunstdarstellungen im Treppenturm des Schlosses Rosenborg (anzusehen im "Royal Danois", dem neuen Knabstrupperbuch von Bent Branderup) finden sich folgende Gemälde mit unterschiedlich starkem Pinky-Push der Gertenhand:
Passetemps im Terre-a-Terre,
Fanfaron in der Ballotade,
Pompeux in der Kapriole.
Den stärksten, sozusagen den "Pinky Push Maximus", nutzt der Reiter des Hengstes Pompeux für das Auslösen der Kapriole. (Leider bin ich noch nicht soweit, das selbst zu probieren.)
Es ist also sicher mehr als nur ein kleines Fünkchen Wahrheit an Bents These, dass die dänischen Pferde damals nicht zuletzt auch deshalb in aller Welt so begehrt waren, weil ihre Reiter sie mit dieser außergewöhnlichen Brillianz präsentieren konnten!
5.11.16.: Erkenntnis des Tages:
Schon Pluvinel hielt die Gerte fast immer im "Boquetgriff" (als hielte man einen Blumenstrauß).
Das Gegenteil, den "Anglergriff" (Daumen am Gertenschaft aufrecht aufgestellt zum Stabilisieren der Angel beim Auswerfen) nutzte ich häufig, um die Gerte zu stabilisieren.
Wie ich schon am 26.10. herausgefunden habe, blockiert der Anglergriff den Pinky Push massiv. Heute nun habe ich bemerkt, dass man den Pinky Push (also das Reiterbecken nach vorn kippen) deutlich verstärken oder sogar ersetzen kann , wenn man den Daumen hinter der Gerte senkrecht stellt und mit ihm gegen den Schaft drückt!
Daraufhin habe ich nochmal den Anglergriff probiert und wieder festgestellt, dass dieser das Reiterbecken nach hinten kippen lässt (also die Versammlung unterstützt).
Die Rosenborgdarstellung des Hengstes Recompence bedeutet also, dass der Reiter in diesem Moment eine Versammlung einleitet, möglicherweise ist hier eine Schrittpassage dargestellt.
Auch zur Unterstützung der Levade des Hengstes Mars wird hier der Anglergriff eingesetzt.
Kein Wunder, dass Paco beim Angaloppieren früher sich fast immer in eine Courbette erhob (einmal sogar eine gesprungen war) und auch Picasso immer im Terre-a-Terre ansprang: Ich saß nicht schwer nur auf der Vorhand durch die pronierten Hände und kippte dadurch mein Becken nach hinten, sondern drückte auch noch im Anglergriff massiv auf den Gertenschaft!
Darstellungen mit Anglergriff im "Royal Danois": Svan, Mars, Imperator, Tyrk, Recompence
Update 22.12.16 und 04.02.17:
Nachdem ich die Anleitung Eisenbergs für das Auslösen des Schulterhereins erfolgreich ausprobiert und teilweise in meine Hilfengebung eingebaut hatte, versuchte ich als nächstes, seine Art des Kruppehereins mit ca. 80° Abstellung zu erlernen: leider war das auf eine sanfte Weise nicht möglich und ich musste das Projekt nach 2 Tagen entnervt aufgeben.
Als ich daraufhin zufällig bei Gueriniere nachlas, entdeckte ich seinen scharfen Kommentar zu dieser Lektion, mit dem er auch große Reitmeister kritisierte, darunter Pluvinel, Newcastle (S.234), Eisenberg (S.38) und Ridinger (selbst für diese Größen der Reitkunst gilt also gelegentlich: "Nobody is perfect!"). (Siehe z.B. Branderup/Kern S.73 [hier wird seine Kritik nur auf das „Schulterheraus“ = „Konterschulterherein“ bezogen]).
Gut, dass ich (bzw. eigentlich meine Pferde) frühzeitig selbst erkannt hatte, wie gefährlich und schädlich diese Lektion ist!
Seitdem reite ich meistens Kruppeheraus und habe begonnen, Guerinieres viel stärkeres Croupe-au-mure anzuwenden, das er selbst als Schenkelweichen mit Kopfstellung in die Bewegungsrichtung bezeichnet, mit einer Abstellung von ca. 80°. Beim längeren, jüngeren Picasso geht das gut voran, beim älteren, kürzeren Paco mit seinem kurzen, sehr starken Rücken ist es schon bedeutend schwerer!
Diese Abstellung von 80° zur langen Wand (das entspricht 10° zur kurzen Wand, auf die man zugeht) taucht mit demselben Wert in vielen Übungen wieder auf: Gueriniere nutzt sie in der Traversale, im Karree, in der Demi-Volte und Pirouette.
Das wichtigste Zeichen für ein gelungenes Croupe-au-mur ist, neben der Beibehaltung der genau gleichen Abstellung, wenn das Pferd das äußere Vorderbein in einem schönen Bogen über das innere führt, denn das geht nicht, wenn es auf den Schultern liegt. Keinesfalls darf das innere Vorderbein einen großen, spektakulären Ausfallschritt machen, weil es damit auf die Vorhand kommt und obendrein häufig die Hinterhand verliert, sodass diese aus- und das Pferd auseinanderfällt. Es würden die drei wichtigsten Ziele dieser Übung verfehlt: Das Aufrichten der Vorhand, das vermehrte Untertreten der Hinterbeine und die Vorbereitung auf den Seitwärtsgalopp in genau derselben Haltung und Abstellung. Ich meine, schon nach 10maliger Anwendung eine deutliche Zunahme der Schulterfreiheit des Pferdes zu fühlen.
Kruppeherein wende ich an der Wand nur noch selten an, und wenn, dann mit mindestens 2m Abstand des Pferdekopfes zur Wand, wie es de la Broue und Gueriniere (für Ausnahmen) gerade noch als zulässig ansehen.
Update 08.01.2017:
Hält man die Fleck Dressurgerte zwischen den Oliven, ergibt sich ein viel zu langer Überstand nach unten. Gueriniere empfiehlt ja ohnehin, das Ende der Gerte in der Faust verschwinden zu lassen. Beim Umstieg auf eine Naturgerte habe ich heute festgestellt, dass sich auch hierbei eine Pinky-Push Blockade ergeben kann, wenn die Gerte mittig in der Handfläche endet (so wie oben beschrieben bei der Olive); man muß also das Gertenende tiefer, auf dem Kleinfingerballen, abstützen, wenn man den Pinky Push nutzen will. Ich nenne diese Gertenhaltung Semi-Bouquetgriff (Gertenende verschwindet in der aufrecht stehenden Faust).
28. Jan. 2017: 400 Jahre alte Bestätigung entdeckt
Beim heutigen Stöbern im de la Broue fand ich heraus, dass er (anscheinend als einziger der alten Meister) einen direkten Zusammenhang zwischen einem eingezogenen Bauch und dem Einrollen der Schultern beschrieb: der Reitersitz solle: "den Reiterbauch etwas vortreten lassen(d), damit die Schultern nicht gewölbt werden" ("L'estomac un peu avancé pour ne paroistre avoir les epaules voultees").
Je älter der Mensch ist, desto häufiger tritt ein Rundrücken auf. Das bedeutet, es hat sich eine Hyperkyphose des oberen Teils der Brustwirbelsäule (eine Art runder Buckel) gebildet, die zu einem Hochrutschen der Schulterblätter führt und mit den permanent eingerollten, nach vorn gekommenen Schultern verhindert, dass die Schwingungen im Reiterrücken absorbiert werden.
In diesem Falle kommt der Pinky-Push nicht oder nur minimal durch: der Reiter muss daher versuchen, aktiv den Bauch vorzuschieben um sein Becken aktiv nach vorn zu kippen, wenn das Pferd zulegen soll. Außerdem muss er teilweise den Oberkörper weiter nach hinten halten, auch um ein Vorfallen seines Kopfes zu minimieren.
Die Supinationshaltung der Hände bringt beim ausgeprägten Rundrücken ebenfalls nicht den maximalen, aber trotzdem einen spürbaren Effekt.
Jeder Mensch muss ständig auf eine gute Körperhaltung achten und sich mindestens 50x am Tag korrigieren: beim Gehen, Liegen,Stehen, Sitzen, am Schreibtisch, am Rechner (Vertikalmaus), beim Autofahren,etc.
Die Bundeskanzlerin weiß das auch: die Merkel-Raute läßt sie nicht nur gut dastehen, sondern ist gleichzeitig eine aufrichtende KG-Übung.
Es gibt sehr gute Yoga-, KG-, Atemgymnastikübungen im Internet, um dagegen an zu wirken und die Dehnung der stark verkürzten Bauchmuskeln und die Straffung der Rückenmuskeln zu ermöglichen.
2/3 aller Betroffenen spüren zunächst viele Jahre lang keinerlei Schmerzen, so ist ihr Leidensdruck gering.Vielleicht wirkt hier ja der Wunsch nach einem guten Reitersitz als „Kandare mit aufrichtender Wirkung“?
Update 05.02.17:
Inzwischen ist mir klargeworden, dass die Supination der Gertenhand nicht nur den Zweck erfüllt, den Reiterbauch etwas vortreten zu lassen, sondern auch durch die Aufhebung der Daumendruckeinwirkung auf die Stellung des Reiterbeckens vorteilhaft ist: er liegt hier zwar manchmal genauso längs der Gertenschaftes wie beim Anglergriff, kann aber durch die Drehung der Handfläche nur zur Seite einwirken. So passiert nichts, wenn der Reiter mal klemmig wird und den Daumen andrückt.
Update 19.02.17:
Nicht nur die Supination der Gertenhand neutralisiert den Pressdaumen: ebenso wichtig ist eine starke Streckung des Zeigefingers längs des Gertenschaftes: ich nehme an, dass die Streck- oder die Beugesehne des Zeigefingers den Oberarmmuskel blockiert, der ansonsten das Vorschieben des Schulterblattunterrandes (und damit die Kippung des Reiterbeckens nach hinten) auslösen würde.
Wenn der Reiter dies weiß, hat er einen vorzüglichen zusätzlichen Anreiz, auf die korrekte Handhaltung zu achten: bei mir ist z.B. das Croupe-au-mur nach links im Linkshändersitz besonders schwierig: wie wohl die meisten, habe ich zunächst den Gueriniere-Sitz im Rechtshändersitz trainiert, und erst nach Monaten auch im Linkshändersitz, so dass letzterer immer eher der weniger geübte ist. Dazu kommt, dass Picassos schlechter biegsame Seite die linke ist.
Mein Sitz fällt also hierbei besonders schnell auseinander und ich werde klemmig mit der Folge, dass das Pferd im Croupe-au-mur rückwärts gehen will. Hier stört ein einwirkender Pressdaumen massiv: wenn mir das bewusst wird und ich den linken Zeigefinger stark strecke, das das testweise seitliche Andrücken des Daumens an die Gerte keinerlei Muskelbewegung in meinem Rücken erzeugt, kann ich wesentlich besser korrigierend einwirken: es kommt zu einer spürbaren Erleichterung!
Wenn ich nun die Gertenfaust (jetzt die linke) eine Fausthöhe tiefer stelle und den linken Kandarenzügel in den kleinen Finger einhake, wirkt dieser mit einer bisher ungeahnten Leichtigkeit und Präzision ein, und ich kann ihn ebenso leicht durchhängend einsetzen wie beim einhändigen Reiten!
Update 02.03.17: Neue Bezeichnungen erforderlich!
Wenn der Reiter keinen symmetrischen Sitz benutzt und immer wieder die Sitzweise wechselt, verlieren „rechts“ und „links“ ihren eindeutigen Bezug, es sei denn, man möchte immer dazusetzen: „im Linkshändersitz“/“Rechtshändersitz“.
Deshalb benutze ich jetzt folgende, eindeutige Begriffe:
- die „Gertenhand“, bzw. die „Zügelhand“;
- für die Bahnrichtung: „auf der Zügelhand reiten“/ „auf der Gertenhand reiten“;
- für die Zügel: „Gertenhandzügel“ oder „Gertenzügel“ / “Zügelhandzügel“;
- für den Gerteneinsatz: „von der Gerte weg gebogen“ (= Gerte parallel zum Pferdehals); „zur Gertenhand gebogen“(= Gerte gekreuzt über den Mähnenkamm), oder „zur Zügelhand gebogen“;
Sauniers Handhaltung weicht etwas von Guerinieres ab, die Beschreibung wäre dann:
Ist das Pferd zur Gertenhand gebogen, wird die Gertenhand immer tiefer gehalten, um im Bedarfsfalle mit dem kleinen Finger in den Gertenzügel greifen zu können.
Ist das Pferd zur Zügelhand hin gebogen, wird diese tiefer gestellt.
Im Geradeaus ohne Biegung werden beide Hände in gleicher Höhe, dicht beieinander, gehalten.
Zwischenbilanz 02.März 2017:
Ein Jahr ist nun vergangen, seit ich die ersten zaghaften Versuche in Richtung Guerinieresitz unternahm; er hat mich zunehmend fasziniert und ich habe seitdem folgendes gelernt:
Mein anfängliches Ziel, die rechte Hand immer tief zu stellen, hat sich für die Linksstellung und das Gerade-Gerade nicht bewährt: nur in der Gertenhandbiegung wandert sie nicht von selbst hoch., ist das Pferd aber anders gebogen, behindert sie nur.
Das Ziel: „Hände nie in Pronation“ hat sich sehr bewährt! Bald musste ich das „nie“ allerdings etwas einschränken: man muss ja die Zügelhand deutlich pronieren, wenn man eine Wendung zur Zügelhandseite einleiten möchte.
Das Ziel „Der Daumen der Zügelhand zeigt immer nach vorn“ hat sich als sehr gut herausgestellt (leichte Abweichungen, bei denen er etwas (bis 20°) zur Gertenhandseite zeigt, schmälern m.E. den Wert dieser Grundregel nicht.
Meine Entdeckung des Pinky-Pushes in diesem Forschungsjahr ist mein ganzer Stolz und war nur möglich durch den Wechsel von der pronierten zur vorwiegend supinierten Handhaltung. Ich halte ihn für einen großen Schritt vorwärts und hoffe, damit meinen Einsatz von Sporen ganz oder wenigstens zu 90% abschaffen zu können, ganz im Sinne des alten, von Newcastle zitierten Sprichwortes, : “Ein freies Pferd braucht keine Sporen!“
Die dritte Säule meines Gueriniere-Sitzes sollten die nach vorn gehaltenen Beine sein. Dies stellte sich anfangs sehr schwierig dar, wurde aber mit dem Einsatz des Pinky-Pushs wesentlich leichter. Die Formulierung "Der Reiter soll seine Beine in der Regel „vor dem Pferd“ haben, entstand zwar zunächst durch einen Übersetzungsfehler bei meiner mühseligen Wort-für-Wort Übersetzung des Broues, ich behalte diese Formulierung aber bei, da sie sehr gut mein Sitzgefühl wiedergibt. Durch diese Beinhaltung hat sich meine Sitzeinwirkung und Haltung wesentlich verbessert.
Seit ich herausfand, wie der Pressdaumen wirkt, habe ich sehr lange nur an der Vermeidung dieser versammelnden Wirkung gearbeitet. Mit dem entlang der Gerte ausgestreckten Zeigefinger gelingt das nun sehr gut und ich habe vor kurzem sogar damit begonnen, den Pressdaumen ggf. mal gezielt einzusetzen.
Update 14.03.17: Der "vorgeschobene Unterhals" als Qualitätsmerkmal bei Gueriniere
Durch die Beschäftigung mit dem Croupe-au-mure bin ich auf die zahlreichen Bilder bei Gueriniere gestoßen, in denen ein sogenannter "vorgeschobener Unterhals" des Pferdes erscheint. Nun habe ich bis heute, wie die meisten von uns, geglaubt, dies sei ein sicheres Zeichen für einen weggedrückten Rücken. Wir kennen die Bilder des falschen spanischen Schritts mit vorn hoch heraustretenden Vorderbeinen und einer nachschleppenden Hinterhand, der ein Nach-oben-Kippen des Pferdebeckens und weit nach hinten raustretende Hinterbeine mit sich bringt: dies führt zu einem Senkrücken und kissing spines. Bei Gueriniere aber werden die Hinterbeine weit nach vorn untergesetzt, das Pferdebecken kippt nach unten und der Rücken wölbt sich auf: hier sollte gar kein Senkrücken möglich sein!
Der bei ihm sichtbare Unterhals, bedeutet, dass die Vorhand maximal aufgerichtet ist, und das Gewicht der Vorhand dadurch soweit wie möglich nach hinten auf die Hinterbeine verlagert wird: die Vorhand wird frei (von Gewicht) und damit viel freier, sich zu bewegen!
Besieht man in diesem Lichte die Bilder auf der Fundstücke-Seite, wird deutlich, dass häufig ein leicht sichtbarer Unterhals bei den bestgerittenen Pferden ihrer Zeit stolz abgebildet wird.
Update 22.03.:
In der letzten Woche haben mich meine Pferde belehrt, dass ein zu sehr nach hinten genommener Oberhals und Kopf des Pferdes tatsächlich den Rücken absenken läßt: so muss ich den Versammlungsgradienten zunächst deutlich auf einen kleineren Bereich relativieren. Wenn es möglich ist, würde ich ihn gern demnächst mit einer PC-gestützten Video- und Auswertungssoftware bestätigen und so die Grenzen von beginnender "Anti-Versammlung" durch Voneinander-weg-Streben von Hinterhand und Vorhand auf der einen Seite, und einem zu weit nach hinten kommenden Oberhals auf der anderen Seite festlegen. Bis dahin kann ich weiter nur versuchen, mich auf mein Sitzgefühl zu verlassen, um rechtzeitig ein Absenken des Rückens zu erkennen.
Aufrichtungswinkel
Mein Eindruck ist, dass die alten Meister den Oberhals nur bis zur Senkrechten auf der Körperachse zurücknahmen, alles dahinter aber als schädlich betrachteten. So ist der sichtbare Unterhals wohl nur dann als Anzeichen für einen Fehler anzusehen, wenn der Oberhals hinter diese Senkrechte zurückgeführt wird.
Als Definition dieses Aufrichtungswinkels würde ich daher formulieren: Winkel der vorderen Halskante zur Körperlängsachse.
Maximale gute Aufrichtung mit sichtbarem Unterhals:
weggedrückter Rücken:

In der Skizze von Pablo Picasso entsteht der weggedrückte Rücken durch „Anti-Versammlung“, bei der Vorder- und Hinterbeine auseinanderstreben, hierbei entsteht ein Senkrücken, der eine starke Einschränkung der Tragkraft mit sich bringt.
zu weit zurückgeführter Oberhals:
Bei dem Lecomte Hippolyte und bei der indischen Schulparade dagegen tritt der zweite große Fehler beim Versammeln auf: der Oberhals wird zu weit nach hinten geführt.
Bei
dem Lecomte Hippolyte und bei der indischen Schulparade dagegen tritt
der zweite große Fehler beim Versammeln auf: der Oberhals
wird zu weit nach hinten geführt.
Versammlungsgradient
Der Aufrichtungswinkel allein sagt noch nichts über das Ausmaß der Versammlung aus, denn zu dieser gehört auch die vermehrte Lastaufnahme der Hinterhand.
Am stehenden, hochversammelten Pferd kann man besonders gut sehen und messen, worauf es Broue, Newcastle, Gueriniere und Saunier ankommt, daraus habe ich den Versammlungsgradienten entwickelt: zieht man vom Höhepunkt des Nackens, dem Atlantoaxialgelenk, eine gerade Linie zum am weitesten hinten stehenden Hinterhuf (der die meiste Last trägt), ist diese Linie umso weniger geneigt, je dichter diese Punkte beieinander liegen. Dieser Gradient (= Steigung oder Neigungswinkel) ist bei den Pferden von vielen Dingen abhängig: vom Rahmentypen, von der Halsform, von der Stärke und Art der Hüftenbeugung, aber auch von der Lektion: Schulparade und Courbette (Levade) auf der Stelle, Piaffe, Trabpassage, Schrittpassage in Bewegung usw. und ist nur anwendbar, wenn a) keine Anti-Versammlung stattfindet und b) der Aufrichtungswinkel zur Körperachse 90° nicht überschreitet.
In der Schulparade kann man sehr gut beobachten, wie die Schulterfreiheit (von Gewicht) mit dem Steilerwerden des Versammlungsgradienten zunimmt: in der gebogenen Schulparade wird zunächst eine Schulter ganz von Gewicht befreit und dieser Vorderhuf hebt als erster vom Boden ab, und erst wenn das komplette Pferdegewicht auf den Hinterbeinen liegt, folgt das Abheben des anderen Vorderhufes.
Gemessene Werte: Die meisten Pferde auf der Fundstücke-Seite stehen im Quadrattyp, deshalb gebe ich im Folgenden keinen Rahmentypen an! Alle Werte nur Annäherungswerte, da die Pferde häufig etwas seitlich dargestellt wurden! ).

Die griechische Schulparadenstatue hat einen Versammlungsgradienten von ungefähr 70°,
Der Sarazene aus der neapol. Krippe hält sein Pferd in einem Versammlungsgradienten von 69°,
römischer Siegelstein: 65°
Etude pour la course des Barberi: zum vorderen,belasteten Hinterfuß: 72°
Vendome: 68°
Reiterin im Bois de Bologne: 62°
Die mesopotamische Schulparade: 58°,
Napoleon auf dem Schimmel: 59°
Schulparade im Parthenonfries: 70°
La Broue,Newcastle, Gueriniere und Saunier benutzen einen hohen Aufrichtungswinkel und einen steilen Versammlungsgradienten zur Entlastung der Vorhand in vielen Lektionen: z.B. im Schulterherein, Croupe-au-mure sowie für die Traversale in der Pasege (und Passage?) und in der Demi-Volte.
Vielleicht werden wir irgendwann erkennen, dass ein bestimmter Versammlungsgradient (z.B. die 80° der unten abgebildeten Courbette) die Grundlage für ein ermüdungsarmes Hüpfen in Courbetten ist?

Ideale Levade/ früher Pesade bei Gueriniere, (die Kopfhaltung des Reiters ist falsch dargestellt: künstlerische Freiheit des Malers)
Update 12.April 2017
Habe gestern bei La Broue gelesen, dass für einen korrekten 85°-Seitwärtsgang die Voraussetzung ist, dass Rumpf und Hals des Pferdes nicht gebogen werden. Jetzt ist mir klargeworden, warum Saunier das Tieferstellen der inneren Hand damit begründet, dass nur der Kopf gestellt werden soll : er verhindert damit einen „um sich herum biegenden, inneren Zügel“!
Auch Gueriniere schreibt, dass für den Seitwärtsgang Rumpf und Schultern gerade bleiben sollen!
Damit habe ich das Rätsel der Handhaltung Guerinieres nun vielleicht komplett gelöst!
Stellt er die Gertenhand tief, damit der innere Zügel den Pferdehals so wenig wie möglich berührt, um beim behutsamen Straffen des inneren Zügels der Trensenkandare möglichst wenig Halsbiegung auszulösen,
supiniert er die Hand, um einen erhabenen, aufrechten und freien Sitz zu erhalten.
streckt er den Zeigefinger längs des Gertenschaftes aus, um nicht versehentlich einen Pressdaumen einwirken zu lassen.
Update 16.April 2017/09. Mai 2017:
Nach viermonatigem Einüben des 80°-Seitwärts-Schrittes als Croupe-au-mure (Gueriniere fordert hierzu, die äußere Schulter des Pferdes auf einer Linie mit seiner inneren Hüfte zu halten), im Renvers-Karree (mit Vorhandwendungen in den Ecken) und Normal-Karree (Kruppe zur Mitte, mit Hinterhandwendungen in den Ecken) und gelegentlichen Versuchen, im Gelände dieselbe Abstellung im Seitwärtsgalopp zu erhalten, ist mir heute erstmals gelungen, bei einer Trabpassade die im 80°-Seitwärts-Schritt begonnene Demi-Volte mit zwei Terre-a-Terre Sprüngen zu schließen. Broue nennt diesen Seitwärtsgalopp am Ende der Demi-Volte „Terre-a-Terre“; (siehe Band 2, S.43).
Newcastle sieht den diagonalisierten Schritt als Ergebnis des Seitwärtsgangs (bei ihm z.B. als Travers mit der Kruppe zum Pilaren, das beim ihm die Bezeichnung "halbe Schulter vor" hat). Er sagt, wenn die Vorderbeine kreuzen, greift das innere Hinterbein aus, und wenn die Hinterbeine kreuzen, greift das innere Vorderbein aus: das ist dann eine Trabaktion (= diagonalisierter Zweitakt).“
Er schreibt auch über das Seitwärts: "wenn die Vorderbeine kreuzen, wird die Vorhand eng, und gleichzeitig die Hinterhand weit durch das Ausgreifen des inneren Hinterhufes. Wenn dagegen die Hinterbeine kreuzen, wird die Hinterhand eng, und gleichzeitig die Vorhand weit durch das Ausgreifen des inneren Vorderbeines. So ist das Pferd im vollen Seitwärts immer in einem halben Terre-a-Terre: dem Terre-a-Terre der Hinterhand, wenn diese weit ist, und im anderen Moment im Terre-a-Terre der Vorhand, wenn letztere weit ist".
Update 23.04.2017:
Beim gestrigen Versuch, eine Traversale im Schritt zu reiten, ging mein Pferd wie selbstverständlich zunächst seitwärts: ich war völlig erstaunt! Aber kein Wunder nach monatelanger Seitwärts-Arbeit! So musste ich ihm nun explizit sagen, wie viel Vorwärts noch dazu kommen sollte! Dabei wurde mir klar, dass meine jahrelangen Trabtraversalenversuche im Arbeitstrab völlig falsch gedacht gewesen waren!
Es fällt mir sehr schwer, von der heute üblichen, raumgreifenden Trabtraversale (eher auf der Vorhand) umzudenken auf eine Seitwärts-Schritt-Traversale mit sehr hoher Aufrichtung und auf der Hinterhand!
Wenn Gueriniere beim Wechsel durch die Bahn auf zwei Hufschlägen davon spricht, dass La Broue sagt, der Reiter müsse sehr sorgfältig das Übertreten des äußeren Vorderbeines über das innere in einem bestimmten Moment unterstützen, erinnert mich das nun an die Art, wie ich im Seitwärts-Schritt mein Pferd zu unterstützen versuche.
Jetzt mach ich lieber eine steile, aber kürzere Seitwärts-Schritt-Traversale, da ich von früher her immer noch viel zu ungeduldig bin, den Wechsel zu beenden... Außerdem gelingt im Seitwärts-Schritt der Wechsel durch Umkehrung der Schultern viel besser.
Update 29.04.17:
Seit ich Sauniers Bezeichnung „Schrittpassage“ fand, vermutete ich, dass mit Passage, die in einigen Texten nur Königen und Fürsten erlaubt war, häufig gar nicht ein Schwebetrab, sondern die Schrittpassage gemeint war, und jetzt habe ich erstmals einen Text gefunden, der das bestätigt: im Kapitel „ Über das Geradeaus-Passegieren und wann und wo es anzuwenden ist“, schreibt Nicolas di Santa-Paulina (1696) im L'Arte de cavallo, S.96:
"Es gibt vier Arten, ein Pferd zu passegieren [....] Die Trabpassage ist geeignet für junge und für bizarre Reiter. [....] Man kann auch im Schritt passegieren, das bedeutet, dass es wie im Trabe die Hinterbeine und die Vorderbeine anhebt, aber nicht in ganz exakt demselben Moment wie im Trab, sondern mit einer unspürbaren Pause vor der Bewegung des anderen Beines, das Pferd hebt das Vorderbein höher als das Hinterbein, und wenn das andere (Paar) in gleicher Höhe gehoben wird, spricht man hier von der Passegio, die, auch wenn sie nicht so anmutig ist wie im Trabe, trotzdem majestätisch und angebracht für einen Fürsten ist.“
Die Schrittpassage geradeaus wurde also auch von hochgestellten, mächtigen Personen angewendet.
Update 21.Mai 2017:
Nachdem ich vor einigen Tagen ein paar schöne Terre-a-Terre Sprünge an der Hand erreicht habe, hat sich Paco heute im Croupe-au-mure an der Hand, nach einem versehentlich ausgelösten Terre-a-Terre Sprung rückwärts, beim nächsten so weit bremsen lassen, dass er nur die Hinterbeine vorsetzte, aber die Vorderbeine nicht vom Boden abhob: so stand er mit einer sehr abgesenkten Kruppe da und ließ sich sogar dazu bewegen,daraus 2 Schritte im Seitwärts mit dieser starken Absenkung zu machen; vielleicht wird das mein Weg , um einen starken Versammlungsgradienten im Seitwärts zu erreichen?
Mein Trainingsprogramm (in der Halle) beginnt immer mit der Schulparade an der Hand und weiter à la Gueriniere (zuerst allerdings in Handarbeit): Schulterherein (35°) im Schritt auf beiden Händen, dann Croupe-au-mure (80°) im Schritt auf beiden Händen, dann aufsitzen und Geraderichten im frischen Trab auf der Mittellinie durch die Länge der Bahn, dann wieder Schulterherein und Croupe-au-mure im Schritt, diesmal im Sattel.
Für den 80°-Seitwärtsgang platziere ich die Gerte wie in dem Holzschnitt bei Sébillet schräg nach vorn unten vor der inneren Schulter (am Boden führe ich das Pferd von außen).
Update 07.Juni 17:
Inzwischen ist mir klargeworden, dass ich beim Guerinieresitz nicht nur die Beine vor dem Pferd habe (manchmal nur sehr wenig, aber immer spürbar!), sondern auch meinen Bauch; und weil mein Oberkörper nicht mehr nach vorn geneigt ist, wird auch dieser vor der Bewegung des Pferdes gehalten: der Reiter fühlt sich getragen wie ein Schiff vor dem Wind! Jetzt nenne ich es: Der Reiter sitzt vor dem Pferd.
Rückblickend fühlt sich der alte Sitz dagegen an, als schiebe man eine Schubkarre vor sich her, die Reiterbeine und den Bauch hinten, den Oberkörper nach vorn und den Kopf nach vorn unten.
Update 07. Juli 2017:
Beim Erforschen des Fersenanhebens ist mir ein weiterer, wichtiger Vorteil des "Beine vor dem Pferd" aufgefallen: testet man nach langen Monaten wieder einmal das falsche Hochziehen der Fersen im herkömmlichen Sitz mit den "Beinen hinter dem Pferd", prallt der Reiter immer wieder mal gegen den vorderen Teil des Sattels/die Galerie: diese unangenehme Nebenwirkung des herkömmlichen Sitzes hatte ich inzwischen schon ganz vergessen!
Update 24.Juli 2017
Nach der letzten Supervisionsstunde bei Marius ist mir klargeworden, dass Guerinieres Erfindung des Begriffes „Croupe-au-mure“ zwar wunderbar geeignet ist, das Seitwärts mit dem Kopf an der Wand zu unterbinden, aber den Nachteil hat, dass die Wand lang ist: Der Reiter tendiert sehr dazu, viel zu früh die gesamte Länge der Wand im Seitwärts reiten zu wollen.
Besser ist es wohl, den Ansatz La Broues zu verfolgen: nur ein bis zwei Schritte Schritte seitwärts (und diese kombiniert mit etwas Vorwärts) zu reiten und dann vier bis fünf Schritte geradeaus vorwärts, und dies über Wochen immer mehr zu steigern.

Da diese Übungen zunächst traversaleartig beginnenn, denkt man sich besser, wie immer in der Traversale, die beabsichtigte 85°-Abstellung zur Wand entlang der man sich bewegt (hier die kurze Seite der Bahn) besser als 10°-Abstellung zur Wand, auf die man sich zu bewegt (im Bild die rechte Seite der Reitbahn).
Update 12.08.17:
Während des Urlaubs hatte ich Muße, über Nestiers Schulparade in ihrer wunderbaren Leichtigkeit nachzudenken und diese Abbildung in Ruhe zu analysieren:.
Er nutzt den Guerinieresitz: die Zügelhand steht aufrecht mit nach vorn zeigendem Daumen (wohl mit ca. 10° minimal supiniert); die Gerte endet innerhalb der Hohlhand des Reiters.
Seine Beine hält der Reiter vor dem Pferd.
Zur Erzeugung der Schulparade zieht er die Schulterblätter etwas stärker zusammen und weiter nach unten, hierdurch wird das Brustbein des Reiters deutlich nach vorn geschoben; er entlastet den mittleren Rücken des Pferdes durch leichtes Anheben der Ferse, und den oberen Brustkorb des Pferdes durch den beidseitigen Bügeltritt welcher die Oberschenkel des Reiters öffnet. Mit der Zügelhand übt er einen leichten Pinky-Pull aus, was zum einem Abkippen des Reiterbeckens nach hinten führt. So wird der Reiterrücken zum Ebenbild des Pferderückens: Aufrichtung der Vorhand mit Abkippen des Beckens.
Er zeigt hier die spezielle, sehr schwierige Zügelführung zur Unterstützung der Rechtsbiegung beim noch nicht gut ausgebildeten Pferd: er führt den rechten Trensenkandarenzügel, wie 20 Jahre vorher von Gueriniere beschrieben, mit der tiefgestellten rechten Hand. (Ein Reiter, der erst seit wenigen Jahren akademisch reitet, sollte bei Problemen mit der Rechtsstellung seine Pferdes lieber in den Linkshändersitz wechseln, um weiter einhändig reiten zu können!)
Erschwert wird die hierfür notwendige Präzision der Zügeleinwirkung noch durch eine Kandare mit sehr kurzem Unterbaum, die durch die Reduktion des Zügelwegs schon ein minimales Anziehen des Zügels einwirken lässt.
Abweichend von den Darstellungen in Guerinieres „Ecole de cavalerie“ hält er die Gerte abwärts (in Skistockposition) und führt den rechten Kandarenzügel zwischen Ring-und Mittelfinger. Die Gerte liegt am Oberschenkel an, um an der Gertenhand so wenig Pronation wie möglich zu erzeugen und der Hand etwas mehr Bewegungsfreiheit über dem Gertenende zu verschaffen. Diese Gertenhaltung erschwert ein Rechtsstellen noch zusätzlich, da die Gerte nun nicht mehr an der linken Halsseite, von sich weg biegend eingesetzt werden kann.
Das Seil, das als zweites Zügelpaar dient und gerade nicht benutzt wird, ist für eine normale Unterlegtrense zu hoch über dem Kandarenmundstück befestigt: ob es sich hier um eine ganz besondere Zäumung handelt, bleibt weiterhin unklar.
Die Schaumkette weist darauf hin, dass es sich um eine Trensenkandare handelt.

Mit freundlicher Genehmigung des British Museum
Update 01.Nov.2017:
Der stabile Guerinieresitz ermöglicht folgende sehr feine und leichte Hilfengebung zum Biegen des Pferdes:
Hält man die Gerte in der aufrechten Faust im Semi-Bouquetgriff (Gertenende verschwindet in der aufrecht stehenden Faust) mit einer Vorwärtsneigung der Gertenspitze von nur ca. 10°, wobei das Gertenende in der Hohlhand abgestützt wird, kann man durch Beugen und Überstrecken im Handgelenk ganz fein dosiert eine Biegung auslösen.
Zu Beginn, um seinen eigenen Körper und und den des Pferdes zu sensibilisieren, beginnt man mit der stärksten Beugung/Streckung im Handgelenk: zur Biegung des Pferdes zur Gertenhandseite hin benutzt man eine Überstreckung und hält die Gertenhand hierbei weiter hinten als die Zügelhand. Möchte man z.B. im Rechtshändersitz (Gerte in der rechten Hand) ein Schulterherein nach rechts, dreht man die Faust so nach außen, dass eine maximale Überstreckung des Handgelenks entsteht: die Knöchel (MCP-Gelenke der Finger) zeigen ganz nach rechts; die Gertenhand steht weiter hinten als die Zügelhand, und der Reiter lässt es zu, dass sein linker Oberschenkel etwas mehr gegen den vorderen Teil des linken Sattelblattes drückt. Hierbei kommt die linke Reiterschulter etwas vor.
Möchte er in das Kruppeherein rechts wechseln, braucht er nur die linke Schulter etwas zurückzunehmen und den linken Oberschenkel etwas vom Sattelblatt zu entfernen, was den rechten Oberschenkel vermehrt gegen das Sattelblatt drückt und zu einer Drehung des Pferdes unter ihm ins Kruppeherein rechts führt.
Für die Biegung nach links (zur Zügelhandseite) führt er die Gertenfaust weiter nach vorn als die Zügelfaust, dreht sie aus der Überstreckung in eine starke Beugung, sodass die Fingerknöchel der Gertenfaust nun zur linken Seite zeigen und gestattet wieder für das Schulterherein dem rechten Oberschenkel ein leichtes Anlegen an den vorderen Teil des rechten Sattelblattes; für das Kruppeherein links dreht er wieder das Pferd unter sich.
Auch ein ganz weicher Wechsel aus dem Schulterherein rechts in ein Kruppeherein links ist sehr gut möglich.
Am besten üben kann man das auf einer langen Geraden, z.B. im Gelände, oder aber in einer großen Halle durch die Länge der Bahn (denn nur hier sind die Einwirkungen der Wände auf das Pferd gleich stark).
Dasselbe gilt natürlich spiegelbildlich für den Linkshändersitz.
Nach Erlangen des Gefühls für diese Hilfe und einiger Routine wird man feststellen, dass meist gar keine starke Drehung im Gertenhandgelenk mehr nötig ist, ja z.B. im Galopp sogar dazu führen kann, dass das Pferd sich durch diese sehr leichte Hilfe überfordert fühlt und mit dem Kopf schlägt, oder den Galopp abbricht! Hier lernt man dann schnell, mit wie wenig man auskommen kann, um ein Schulterherein oder Kruppeherein im Galopp zu erhalten.
Möchte man gleichzeitig einen Pinky-Push anwenden, muss man das Gertenende auf dem Endglied des Kleinfingers abstützen und diesen betont nach vorn schieben (dabei kommt die Gerte der Reiterstirn natürlich etwas näher).
Ein gerades Gerade ist dann zwischen diesen Hilfen, minimal angewendet, viel besser zu erreichen!
Update 4.Nov. 2017:
Erst gestern, beim Verfassen der schriftlichen Übersetzung des Kap.25 ist mir klargeworden, dass La Broue das Herüberbringen der Mähne auf die andere Seite auch medizinisch begründet: Es vermehre die Durchblutung der festen Halsseite; eine Lockerungsmöglichkeit verspannter Muskulatur durch Wärme ist ja seit dem Altertum bekannt!
Wie wohl die meisten Reiter nach Begreifen der Tatsache, dass die Mähne fast immer zur gut biegsamen Seite des Halses hängt, hatte ich vor Jahren schon versucht, ob es eine positive Wirkung erbringt, sie umzulegen: leider waren meine Pferde damit nicht einverstanden und schüttelten sich prompt solange, bis sie wieder an alter Stelle lag: jetzt aber, nach vielen Jahren Gymnastizierung lassen sie die Mähne liegen!
Eine vielleicht noch wichtigere Ursache für ein positives Ergebnis ist aber wohl die Reiterpsyche: jahrelang konditioniert, die schlechte Seite mehr zu beachten als die gute, passiert es mir nun, dass ich mich freue, dass sich die mähnenfreie Seite unerwartet so schön rund biegt, und verlange auf dieser Seite gar nicht mehr (es kommt viel weniger zum Überbiegen der guten Seite!), auf der Seite mit der Mähne dagegen gehe ich nun unbewusst davon aus, dass diese die gute ist und bin deshalb auch hier mit einer leichten Biegung zufrieden. Auf beiden Händen bin also häufig viel entspannter!
Da ich das Glück habe, dass beide Pferde unterschiedliche gute Seiten haben (Paco ist Linksträger und Picasso ist Rechtsträger) bin ich gewohnt beides zu bearbeiten: einen schlechtere Rittigkeit aufgrund „Linkshändigkeit“, wie früher abergläubisch unterstellt und von La Broue erwähnt, konnte ich nicht feststellen, vielleicht auch deshalb, weil wir ja heute auch den Linkshändersitz des Reiters zulassen und so alle Pferde gleich bearbeiten können.
Update 25.11.17:
Seit ich vor einigen Tagen das Kapitel 33 aus Band I des Cavalerice zur Vorbereitung meines La Broue Buches erstmals exakt übersetzte, trainiere ich die ganze Parade aus den schnellen Bewegungen nach seiner Art (allerdings nehme ich anstatt des Rückwärtsrichtens eine Schulparade, weil ich befürchte, dass das Pferd sonst nicht mehr zuverlässig unterscheiden kann, bzw. will, und dann das leichtere Rückwärtsgehen bevorzugt, wenn man eine Schulparade auslösen möchte). Dass diese heftige Parade das Pferd so ruhig lässt, hätte ich niemals erwartet: aber die 4-5 Schritte im stark versammelten Schritt, und die 3 folgenden Wendungen beruhigen das Gefühl des Pferdes völlig, und trotzdem spurtet es bei Anforderung sogleich wieder los. Diese Lektion führt jetzt schon zu einer Verbesserung aller anderen, so wie er es beschreibt, und die Pferde bekommen jedes Mal mehr Mut und Selbstvertrauen.

L'Arrêt avec le Cavesson (Die ganze Parade mit dem Kappzaum), Lithographie von Charles Motte, ca. 1830, nach Eisenberg
„Um die ganze Parade mit Anmut zu formen muss das Pferd die Hüftenbeugen, darf es nicht seitwärts übertreten und nicht gegen die Hand drücken, sondern seinen Kopf ruhig, die Halsung hoch und vor dem Reiter tragen. Bei jungen Pferden darf man die ganze Parade nicht zu kurz und zu plötzlich ausführen, um zu vermeiden, ihm die Sprunggelenke und das Maul zu ruinieren. Zum Einleiten muss der Reiter die Waden anlegen, um es zu animieren, er bringt seinen Körper nach hinten, stellt die Hände mit dem Kappzaum und den Zügeln höher, streckt danach kräftig die Knie und tritt in die Steigbügel mit Absenken der Gerte.“
30.11.2017
Beim Übersetzen des Kap. I, 34 musste ich gleich an dieses Bild aus Delft denken: dieser Reiter ist vielleicht durch den Cavalerice beeinflusst worden, die Hinterbeine breit zu stellen.

Delfter Fliese, ca. 1650, der Reiter hat die Beine vor dem Pferd
18.12.2017: Die Beinhaltung: Zwischenbilanz nach 21 Monaten
Den Sitz des Kunstreiters hatte ich deshalb nach Gueriniere benannt, weil in dessen Buch sehr deutliche Abbildungen zu finden sind, die bei Grisone und La Broue leider fehlen; weil ich den Pluvinelsitz falsch finde und weil Newcastle m.E. allzu weit vorne sitzt.
Der Ausdruck „Beine vor dem Pferd“ fiel mir durch einen Übersetzungsunfall zu, und wird von mir seitdem gerne benutzt, weil er so treffend ist.
Ob man seine Beine vor dem Pferd hat, erkennt man daran, dass die Kraft, die man in die Steigbügel tritt, dann durch die ganze Länge des Reiterbeines in seine Wirbelsäule zieht, ohne dass der Reiter aus seinem Sitz kommt, auch nicht, wenn er dabei die Fersen hochzieht. Der musculus gastrocnemius (der hintere dicke Bauch des Wadenmuskels, der zusätzlich zum Anheben der Ferse eine Beugung im Kniegelenk auslösen würde) ist hierbei wenig oder nicht aktiviert, sondern nur der der davor liegende platte Wadenmuskel musculus soleus: der Reiter hat das Gefühl, nur die Seiten der Wade spannen an.
Sind die Beine dagegen hinter dem Pferd, wird diese Kraftlinie in Höhe der Knie völlig unterbrochen, und die Unterschenkel sind nur noch Anhängsel der Kniegelenke, der Reiter verliert deutlich Stabilität in Längsrichtung des Pferdes, aber auch Seitenstabilität, fällt nach vorn und prallt auch sehr häufig unangenehm gegen den vorderen Sattelrand: hierbei ist mehr der hintere dicke Teil des Wadenmuskels, mit dem man das Pferd antreibt, angespannt.

Delfter Fliese, ca 1790; der Reiter hat die Beine weit hinter dem Pferd
Eine mittlere Stellung habe ich noch nicht herausgefunden, es gibt anscheinend nur entweder vor oder hinter dem Pferd. Deshalb ist es mein Ziel, die Beine immer wieder sobald wie möglich vor dem Pferd zu halten, nachdem man sie kurzzeitig nach hinten verlagert hatte, entweder aus alter Gewohnheit (als Fehler) oder weil man sie weiter hinten als Hilfe eingesetzt hat.
Auch mit weit nach vorn gehaltenen Beinen kann diese Kraftlinie im Knie abbrechen, wenn man die Beine „über dem Pferd“ hält [siehe Marc Aurel und mesopotamische Schulparade], auch hier sind dann die Unterschenkel nur Anhängsel der Knie, hierbei haben allerdings die Füße kaum oder gar keinen Kontakt mit der Steigbügeltrittplatte mehr. Hierbei ist gar kein Muskel auf der Wadenrückseite angespannt. (Reitet man ganz ohne Steigbügel, kann man natürlich diese Kraftlinie gar nicht aufbauen, hierbei lässt man die Beine entweder gerade herabhängen oder aber hält sie über dem Pferd).
Wenn man die Beine vor dem Pferd hat, tritt man immer etwas in die Bügel, und wendet dabei Kräfte zwischen 20g und vielen Kilogramm auf, je nach Ziel.
Es ergibt sich dadurch ein wesentlich größeres Fundament für das Reitergleichgewicht als beim Englischsitz, man könnte es als Dreibein aus Gesäß und beiden Füßen bezeichnen: der Reiter steht und sitzt gleichzeitig, wie auf/an einem einbeinigen Stehhocker.
Ein sehr wichtiger Vorteil ist, dass der Reiter die Stöße, die der Pferderücken in der Bewegung durch das Reitergewicht erhält, ganz fein dosiert abfedern kann, je nach Anspannung des platten Wadenmuskels (M. Soleus).
Die Gewichtsverteilung im Kunstreiter-Grundsitz schätze ich so ein: ca. 60% des Reitergewichtes auf dem Gesäß des Reiters, je ca. 15% auf den Oberschenkeln und ca. jeweils nur 1 bis 5% auf jeder Steigbügelplatte (außer beim Bügeltritt).
Beim Bügeltritt allerdings, schätze ich, können gelegentlich um die 50kg auf die betreffende Bügelplatte kommen (da meine Pferde ein breites Fundament haben, kommen sie dadurch nie ins Schwanken).
Die schwierige Gleichgewichtssituation im Englischsitz kostet den Reiter viel Konzentration, von der ein beachlicher Teil beim Guerinieresitz frei wird: der Reiter kann seine Gedanken vermehrt anderen Dingen zu wenden (anfangs fehlt ihm dann tatsächlich etwas!).
Was die alten Meister sagten:
Grisone 1550: Der Reiter soll seine Unterschenkel so herunter hängen lassen, dass sie sich von selbst an ihrem rechten Platz in den Bügeln positionieren, so als stünde man auf der Erde; die Fußspitzen so gedreht, dass sie beim Wenden des Pferdes auf der jeweiligen Seite in dieselbe Richtung zeigen wie die Nase des Reiters.
La Broue 1593: Den Rücken gerade und straff, die Oberschenkel fest am Sattel wie angeklebt. Die Knie geschlossen, und eher nach innen als nach außen gedreht. Die [Unter-]Schenkel so nah am Pferd wie nötig, straff und gerade, so als stünde man aufrecht auf seinen Füßen auf geradem Boden, wenn der Reiter groß oder von mittlerer Statur ist; hat er aber eine kleine Statur, soll er, wenn möglich, seine Unterschenkel nach vorn und den Pferdeschultern benachbart halten.
Die Ferse tiefer als die Fußspitze, weder nach außen noch nach innen gedreht [also ca. 30° außenrotiert wie im normalen Stehen], die Fußsohle soll gerade und mit sicherer Anlehnung an die Steigbügelplatte aufliegen, und so, dass die Stiefelspitze die Steigbügelplatte ungefähr um eine Daumenbreite überragt.
Pluvinel 1626: Der Reiter muss sich ebenso aufgerichtet im Sattel halten, als stünde er auf der Erde, die Unterschenkel weit vorwärts, und fest in die Bügel treten und die Knie allzeit mit ganzer Gewalt geschlossen halten. Mit der Fußspitze nah an den Bug des Pferdes kommen, die Fersen niederdrücken und auswärts drehen, man soll vom Boden aus die Sohlen der Stiefel sehen können.
Bild aus: "Le Manege Royal":

Newcastle (frz.1.Buch) 1657: Der Reiter soll so weit wie möglich vorn im Sattel sitzen, die Beine senkrecht herunterhängen lassen, als würde er auf der Erde stehen, Oberschenkel und Knie wie angeklebt am Sattel, die Füße fest in die Bügel stellen, die Absätze etwas tiefer als die Fußspitze.
Gueriniere 1733: Die Unterschenkel ungezwungen gerade nach unten halten, nicht zu weit nach vorn, da man sie gelegentlich hinten einsetzen muss, nicht zu weit nach hinten, sonst käme man mit den Hilfen in die Flanken, die zu kitzlig und empfindlich sind, um dort mit Sporen arbeiten zu können. Die Ferse nicht zu tief absenken, damit der Unterschenkel nicht steif wird, die Fußspitze nicht zu weit herausdrehen, damit die Sporen nicht den Bauch berühren, und nicht zu weit eindrehen, damit der Unterschenkel nicht gelähmt wird. Eigentlich muss man dazu aber nicht die Unterschenkel etwas einwärts drehen, sondern die Oberschenkel. In seinem Buch findet man auch solche Bilder:



Prizelius (1777) zeigt auf fast allen Darstellungen eine Handgelenksbeugung der minimal supinierten Gertenhand, zusammen mit dem "Beine vor dem Pferd":
Sieht man sich die alten Darstellungen an, wird schnell klar, dass der Rat, die Beine gerade herunterhängen zu lassen, zwei verschiedene Bedeutungen haben kann: ein heutiger Reiter, der im Englischsitz mit den Beinen hinter dem Pferd aufgewachsen ist, meint damit: so, dass noch soeben eine Abknickung im Kniegelenk vorhanden ist, der dickbäuchige m.gastrocnemius noch angespannt (= "nicht in die Bügel treten!"); auf der anderen Seite der Kunstreiter vor 1800, bei dem die Beine soeben noch vor dem Pferd sind, ohne Abknickung im Kniegelenk (= "immer etwas in die Bügel treten!"), außer für kurze Hilfengebungen.
Während das „Beine vor dem Pferd“ heutzutage schon für den Reiter zu Anfang schwer durchhaltbar ist, hat es das Pferd noch weit schwerer: im Englischreiten ist ja das Entspannen des Reiters dadurch gekennzeichnet, dass man alles wegwirft, auch mal die Beine nach vorne entspannt und dies natürlich auch für das Pferd das Pausensignal war, aber nun soll damit erst die richtige, „freie“ Arbeit beginnen!
Das Pferd muss sich sehr umstellen, da der Reiter versucht, möglichst oft und lange die Beine vorne zu halten, hierdurch sind ihm dabei zum Treiben nicht nur „die Sporen gestohlen“ (Pluvinel) worden, sondern auch die Fersen und der dicke Wadenmuskel!
Er muss hier Ersatzmittel finden und lernen, diese einzusetzen: als Erstes fällt ihm natürlich die Gerte ein, aber das allein reicht nicht aus: er muss auch aus dem Sitz auf der Vorhand, der in der Englisch-/Jagd-/Spring-/Rennreiterei üblich ist, auf einen Vorhandentlastungssitz wechseln, der gleichzeitig ein Hinterhandbelastungssitz ist und ein wichtiges Ziel der Kunstreiterei darstellt, indem er den Oberkörper etwas zurücknimmt, die Hände nicht proniert, den Bauch vortreten lässt, die Schultern nicht einrollt, etc.
Zusätzlich muss er dem Pferd erlauben, vorwärts zu gehen, indem er das Becken mehr nach vorn kippt (oder zumindest nicht mehr nach hinten gekippt hält) und ggf. den Pinky-Push einsetzt; und statt des Treibens mit Ferse/Wade/Sporn während des Absenkens des Pferdebrustkorbs auf der inneren Seite einen mehr oder weniger starken Bügeltritt auf dieser Seite benutzen, um die Brustkorbrotation des Pferdes zu verstärken und damit das Untertreten der Hinterbeine.
Zunehmend wird in den bekannten Lektionen das Klammern der Unterschenkel hinten verschwinden, aber in neuen Übungen leicht wieder auftauchen, was nicht unbedingt ein Fehler ist, da das Pferd der Ausführung nur zustimmen kann, wenn es weiß, was es machen soll, und auch der Reiter eine neue Übung selbst erst einmal verstehen muss und dieses häufig ja erst mal nur mit zusätzlichem Treiben gelingt. Diese „falsche“ Hilfengebung kann dann beiden im Verlauf wieder abtrainiert oder ggf. abgeschwächt werden.
Update 23.12.17:
Die Pferdewaage war da: Paco wiegt mit mir und Sattel 660kg. Nur mit der Vorhand auf der Waage zeigt sie 330kg an; die Waage ist 20cm höher als der Boden, auf dem sie und damit Pacos Hinterhand steht und deshalb ist schon etwas Gewicht nach hinten verschoben worden. Als wir unsere Standard-Schulparade ausführten, zeigte die Waage nur noch 240kg für die Vorhand an: 90kg weniger auf der Vorhand bedeutet 90 kg mehr auf der Hinterhand: 420/240kg; anders ausgedrückt: die Vorhand wurde von normalerweise ca. 60% auf 36% erleichtert! Auf den Hüften lagen somit in dieser mäßig starken Schulparade statt normalerweise ca 40% jetzt 64%: Ein echter,leichter Arret sur les hanches!
Update 19.01.18
Immer wieder mal eine ganze Parade auf den Hüften aus dem schnellen Trab und gelegentlich aus dem Galopp zu üben, bringt tatsächlich den von La Broue vorausgesagten Effekt: alle versammelnden und höheren Lektionen werden viel besser, angefangen von der Schulparade und dem stark versammelten Trab!
Seit ich ganz vorsichtig begonnen habe, seine Anleitung für Courbetten anzutesten, habe ich nach vielen Jahren wieder angefangen zu levadieren, was ich lange vermieden hatte, um keine schädliche Pesade auszulösen: La Broue schreibt ja, man solle mit aus der Bewegung ausgelösten Levaden beginnen. Dies hat sich dann bei mir etwas anders entwickelt, so dass ich jetzt aus dem versammelten Galopp an einer leichten Steigung bergauf bei jedem zweiten Sprung die Vorhand des Pferdes etwas anheben kann (mein inneres Bild dabei ist die Delfter Fliese von 1650, die wohl genau dies darstellt, und das Bild von Ridinger, das den relevierten Galopp zeigt).
Dabei denke ich an La Broues Vergleich mit dem Jeu de paulme und es ergibt sich eine dem Baggern beim Volleyball ähnliche Körperhaltung des Reiters: die Reiterbeine sind dann so weit vorn und etwas oben, dass man hier von „den Beinen über dem Pferd“ sprechen muss, auch weil sie im Knie etwas gebeugt sind; und der Zügelarm kommt dabei nach vorn. Zusätzlich verstärke ich das Höhernehmen der Vorhand des Pferdes durch einen deutlichen Pinky-Push und erreiche so zur Zeit gefühlt eine deutliche Entlastung und ein Höhernehmen der Vorhand. Das Anheben der Vorhand führt zu einer Verlagerung des Gewichtes auf die Hinterhand, die dabei weiter vorn unter dem Pferd trägt.
Endlich entwickelt dadurch sich auch das Mezair weiter, weil die Pferde jetzt besser verstehen, dass ich fast auf der Stelle bleiben will. Gestern hat mir Picasso auf dem Rückweg zum Stall, wo die Pferde immer etwas flotter vorwärts wollen, diese Gangart in 45° Abstellung auf seiner guten Seite angeboten und ganz ruhig und locker, fast von allein, acht gleichmäßige Sprünge seitwärts in gerader Körperhaltung gemacht: wohl um zu vermeiden, dass ich auf die Idee käme, ihn seitwärts links gehen zu lassen, weil links seine steife Seite ist und er zu dieser nicht gut seitwärts geht, wenn er schneller vorwärts kommen will. Beim Versuch, das danach auf der linken Hand zu wiederholen, wurde er sehr entier, ging gegen rechte Ferse und rechte Gerte und engte sich sogar zusätzlich nach rechts ein (= bog Körper und Hals stark nach rechts). So wartet auch in dieser Gangart erneut die Gymnastizierung auf uns!
Update 03.03.2018: Tamburinbewegung
Der Semi-Boquetgriff (s.01.Nov.17) verfeinert sich immer mehr: ich brauche nun zum Abstellen der Hinterhand die Gertenfaust nicht mehr vor oder hinter die Zügelhand zu führen: sie bleibt jetzt neben der Zügelhand stehen und wirkt allein durch die Rotation der Faust im Handgelenk. Zum Schwenken der Hinterhand nach links drehe ich die Knöchel der aufrecht stehenden Gertenfaust nach links, zum Schwenken der Hinterhand nach rechts drehe ich die Faust nach rechts, so dass die Knöchel nach rechts zeigen. Diese Schwenkbewegung ist vergleichbar mit dem Schlagen eines Tamburins (Schellenkranzes) gegen die andere Hand, um die Schellen erklingen zu lassen. So leite ich eine Volte nach links ein mit der Drehung der Gertenfaust links, behalte diese Stellung bei, wenn das Pferd die Kruppe in der Wendung behalten soll; möchte ich die Kruppe auf die Kreislinie zurückführen drehe ich die Gertenfaust kurzzeitig nach rechts (länger rechts gehalten, bewirkt dies ein leichtes Renvers). Im Galopp auf Kreisbahnen ist das sehr wirkungsvoll: Beginn mit Drehung nach innen für ein bis zwei Galoppsprünge, dann kurz nach außen zum Stabilisieren des Kreises, dann wieder nach innen zum vermehrten Untersetzen der Hinterhand.
Auch beim 80°-Seitwärts gibt er eine sehr gute Unterstützung: Seitwärts nach links> Knöchel nach links, und vice versa.
Die Übertragungskette über: Unterarm>Schulter>Rückenmuskulatur ins das Reiterbecken und die Sitzbeine ist deutlich fühlbar (vielleicht findet ja jemand irgendwann die einzelnen beteiligten Muskeln heraus?).
Update 06.03.18: Gleichstand mit Newcastle?
Zumindest im Gertenverbrauch fühle ich mich Newcastle inzwischen ebenbürtig: Meine jetzige Naturgerte (ein Apfelbaumtrieb, getrocknet nach der Anleitung in Bents Video) habe ich jetzt über vier Monate in Gebrauch. Newcastle/Cavendish berichtet stolz in seinem ersten Buch, seine Gerte halte häufig ganze drei Monate, als Beweis dafür, wie sanft er mit seine Pferden umgehe. Man könnte einwenden, dass er ja sicher mehr Pferde am Tag ritt als ich, andererseits schreibt er, dass er häufig 5 Pferde in einer Stunde absolvierte: also ist die Einsatzdauer pro Tag vielleicht ähnlich gewesen. Außerdem trug er immer noch zusätzlich Sporen, ich dagegen habe keine Sporen mehr angelegt seit 17 Monaten...
In seinem zweiten Buch allerdings, neun Jahre später, erwähnt er am Anfang, dass seine Naturgerte 6 Monate halte, und am Ende dieses Buches spricht er davon, dass sie ein ganzes Jahr gehalten habe! Ob mein Stöckchen so lange aushält?
Update 10.03.18
Genau in dem Moment, als ich heute Nacht im Notdienst Remlingen passierte (den Ort, an dem Loehneysen sein“Della Cavaleria“ schrieb, und der zu meinem Beritt als Landarzt gehört), wurde mir klar, dass das La Broue Kapitel II.7, welches ich gerade übersetze, genau das ist, worauf Gueriniere sich im Kapitel “Passage“ bezieht!
Update 18.03.2018: Die lang ersehnte Trensenkandare ist da!
Es dauerte ein paar Monate, bis ich erkannt hatte, dass La Broues und Guerinieres „Simple Canon“ =„einfaches dickes Rohr“ (ital. Übersetzung) in Wirklichkeit eine Kandare mit gebrochenem Mundstück ist. Es brauchte dann noch ein paar Wochen Gedankenspiele, die maßstabsgerechte Übertragung der Zeichnungen auf die Maulbreite meiner Pferde und dann einige Wochen Gedankenaustausch bis sie endlich fertig war.
Heute war der erste richtige Testritt mit dieser Trensenkandare: mit ihr kann ich nun genau wie Gueriniere durch minimales Zupfen am inneren Zügel den Unterkiefer des Pferdes nach außen verschieben (was ja der Hauptnutzen einer Trense ist) und dabei bei Bedarf die aufrichtende Wirkung der Kandare nutzen.
Das Mundstück wird konisch nach außen immer dicker, damit die seitlichen Lippen es mittragen können und eine Einwirkung auf das Mundstück zunächst die Lippen, und erst bei stärkerer Einwirkung Zunge und Laden erreicht ( Es wurde hohl ausgeführt, damit es nicht zu schwer wird, wie es auch die Alten gemacht haben: Löhneysens Bezeichnung dafür war „Hohlbiß“). Durch den großen Durchmesser auch noch im Bereich der Laden ist die Rundung sanfter, deshalb wirkt das Mundstück dort weniger hart ein.
Weil es meine erste Zäumung dieser Art ist, habe ich noch nicht gewagt, den Unterbaum genauso lang anfertigen zu lassen, wie Gueriniere und La Broue empfehlen, sondern mich zunächst mit 18cm Länge begnügt. Damit der Hebel nicht zu sehr zunimmt, habe ich den Oberbaum genau wie bei Gueriniere auf 7cm verlängern lassen. So erhöht sich der Hebel gegenüber meiner vorherigen Kandare nur von 1:2 auf 1:2.5 (bei Gueriniere und Broue ist 1:3 ein normaler Wert).
Dadurch gewinne ich einen um den Faktor 1.7 längeren Zügelweg von z.B. statt 4.4cm > 6.3cm. Das bedeutet, dass das Pferd deutlich mehr Zeit hat, auf einen Zügelanzug zu reagieren, bevor die Kandare voll wirkt, und deshalb auch, dass ich mit einer etwas unruhigeren Hand reiten könnte.
Das Gewicht dieses etwas klobig wirkenden Prototypen ist trotz der etwas längeren Bäume dasselbe wie das einer kurzen Turnierkandare plus Unterlegtrense, oder wie einer der schwereren El-Mosquero Kandaren.
Die Kandare lässt den Reiter genauso gut fühlen, wann sie einzuwirken beginnt, wie die Renaissance-Kandare, und nach kurzem Testen hatte ich heraus, wie man am inneren Zügel zupfen muss. Die Stellung des Kopfes war dann wirklich so, wie La Broue es beschreibt: fast nur der Kopf stellt sich, der Hals viel weniger als vorher. Wenn ich dem Pferd zusätzlich die Gerte außen zeige, kommt eine viel rundere Halsbiegung zustande, und ich hoffe, es bleibt dabei, dass der Muskelknoten hinter dem Atlas, der fast immer bei Picasso zu sehen war, verschwunden bleibt. Zum Höherführen des Kopfes reicht ein ganz minimaler Zug (ich setze dazu immer den Pinky-Push ein, um dem Pferd mitzuteilen, dass es sich nicht um eine halbe Parade handelt).
Kleiner Wermutstropfen: die Schaumkette, die den Abstand der Unterbäume voneinander begrenzt und damit ein Hineinlehnen der Oberbäume in die Backenzähne verhindert, und auch die langen Unterbäume verbieten mir von nun an, meinen Pferden zu gestatten, sich an den Zweigen der Büsche und Bäume am Wegesrand zu bedienen..
Update 04.April 18 : aus der Not eine Tugend
Weil die langen Unterbäume meiner Trensenkandare auf dem Boden schleifen könenn und damit wirksam werden könnten, und auch weil das Pferd mit den Hufen daran treten könnte, bin ich jetzt gezwungen, den Pferdekopf viel höher zu stellen. Hatte ich früher im Gelände die Zügel durchhängen lassen, was dazu führte dass die Pferde sehr stark vorwärts abwärts gingen (immer auch in der Hoffnung, ein paar längere Grashalme zu erhaschen), nimmt Picasso jetzt immer eine wunderbar leichte Daueranlehnung, die zu einer fortwährenden Kommunikation über die Reiterhand führt. Ich habe den Eindruck, dass diese vertrauensvolle Weichheit im Pferdemaul durch die Länge der Unterbäume verursacht wird: auch wenn die Reiterhand mal etwas unkonzentrierter gehalten wird, führt dies nicht gleich zum Greifen der vollen Kandareneinwirkung, weil der entsprechende Zügelweg ja viel länger ist. Aber auch die starke Dicke des Mundstückes wird wohl eine Rolle spielen und auch die Möglichkeit des Verteilens der Kräfte der beiden Trensenschenkel, die das Pferd sich passender schieben kann.
Die erwartete Einwirkung des Zupfens am inneren Zügel ist allerdings durch das krasse Gegenteil widerlegt worden, denn dabei stellen meine Pferde Kopf und Hals erstmal auf die Gegenseite! Durch die vier- bzw. achtjährige Benutzung eines nicht gebrochenen Mundstückes wurden beide sehr lange darauf trainiert, die falsche Einwirkung dieser Kandaren umzuinterpretieren und hatten brav umgelernt.
So bin ich gestern im richtigen Bahngalopp, aber trotzdem mit starker Biegung des Pferdehalses nach außen durch die Ecken geritten! Während man im Schritt viel Zeit hat, dem Impuls des Pferdes, sich zur Gegenseite zu stellen, rechtzeitig entgegen zu arbeiten, wird es im Trab schon schwerer, und im Galopp sind ja schnell fünf bis 8 Sprünge gemacht, bevor die sanfte Korrektur (mit Zeigen der Gerte außen neben dem Pferdekopf und verstärkter Sitzeinwirkung) richtig greift! Das verstärkte Anlegen des äußeren Zügels an den Hals interpretiert das Pferd in dieser Situation leider zunächst einmal als einen um sich herum biegenden Zügel....
Update 05.04.18:
Sehr interessante Textstelle bei Prizelius gefunden! (s. Fundstücke).
Update 06.04.2018:
Der Text von Prizelius kommt für mich genau zum richtigen Zeitpunkt: Seit sehr vielen Wochen komme ich bei dem Versuch, den ganz kurzen Schritt zu diagonalisieren, nicht weiter. Nur ganz selten mal für einen oder zwei Schritte stellt sich das Gefühl ein, die Hinterbeine an die Bewegung der Vorderbeine herangeholt zu haben. Deshalb habe ich schon länger überlegt, ob man vielleicht auch durch eine starke Verlangsamung des Trabes zum Ziel kommen könnte. Meine beiden Hengste führen schon länger einen sehr langsamen Trab aus, der mich wunderbar weich sitzen lässt. Die Taktfrequenz von ca. 80/Minute liegt dabei deutlich näher an der einer Trabpassage als an einer Piaffe auf der Stelle. Hierbei entsteht allerdings keine starkes Abheben des Pferdekörpers vom Boden, das ja für Trab, Piaffe und Trabpassage charakteristisch wäre, aber trotzdem den Reiter im Zweitakt deutlich schwingend anhebt: so ähnlich muss sich Saunier in seiner Schrittpassage gefühlt haben, denke ich. Ob das nun wirklich schon eine Schrittpassage darstellt? Zumindest der Weg dahin könnte gut über diese Verlangsamung gehen. Gibt es sogar eine Schrittpiaffe? In einem alten Video der Spanischen Hofreitschule kann man diese Schrittpiaffe sehen, bei der zwei Pferde in der Mitte der Bahn nebeneinander im Stehen sehr, sehr langsam und eher dicht am Boden piaffieren.
Wenn eine Bewegung sich gut für den Reiter anfühlt, ist sie auch gesund für Körper und Geist des Pferdes, sagt man ja: deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass ich damit keinen Fehler mache, sondern im Gegenteil das Pferd damit zum Positiven gymnastiziere. Die alten Meister schreiben ja, dass man sein Pferd entsprechend dessen Fähigkeiten ausbilden soll und kann: manche Pferde heben ihre Beine nun mal etwas weniger grazil und weniger hoch.
Der Text von Prizelius würde dann tatsächlich diese Gedanken bestätigen:
Bei Gueriniere und Saunier hat eine sehr langsame Trabpassage von ihnen den Namen „Schritt“-passage bekommen, weil ihre Bewegung langsamer und dichter, gleichmäßiger am Boden als in einer normalen Trabpassage ist.
Der Schul-“schritt“ bei Prizelius, Eisenberg und Ridinger ist ein sehr langsamer Trab, teilweise mit tiefer Hüftenbeugung, und letzteres wäre genau dieselbe Bewegung wie die o.g. „Schritt“-passage. Als Übersetzungsfehler wurde so im Deutschen aus "pas de escole" (= "Schulgang") der Schulschritt.
Der alte Schulschritt vor ca. 1750 bei Gueriniere und La Broue war ein einfacher, viertaktiger, versammelter Schritt mit höherer Aufrichtung, wie er beim z.b. Schulter- und Kruppeherein notwendigerweise auftritt.
So forme ich den für manche schnell desillusionierend wirkenden Satz aus dem Dictionnaire de Manege von 1741 für uns Amateurreiter mit vielleicht nicht ganz perfekten Pferden und Ausbildungsbedingungen um: Die Schrittpassage ist sehr schwer auszubilden, so braucht selbst ein sehr gut ausgebildeter Reiter für ein sehr gut veranlagtes Pferd mindestens 3 Jahre in der Manege, und wenn in dieser Zeit 2 von sechs Pferden gut werden ist das viel; unter schlechteren Voraussetzungen dauert es entsprechend länger.
Marc-Aurel-Sitz und jeu-de-paulme Haltung
Der Reiter benutzt eine leichte Dorsalextension (Streckung zum Handrücken hin) in der freien, rechten Hand bei leichter Beugung im gleichseitigen Ellenbogengelenk. Wäre letzeres komplett gestreckt, gäbe es keine Übertragung auf die Rückenmuskulatur des Reiters, und damit keine treibende Wirkung. Diese Bewegung entspricht dem Schieben eines Einkaufswagens mit dem Handballen, hier tritt der Reiterbauch mehr vor als beim Pinky-Push, das Reiterbecken kippt hierbei viel weniger vor. (Im Falle eines genauso weit wie hier erhobenen Armes bewirkt die Pronation der rechten Hand keine Blockade des Bauchvorschiebens beim Reiter, wie man erwarten könnte!).
Genau dieselbe Wirkung tritt auf, wenn Marc Aurels linke Hand in Supination einen waagerechten Pinky-Push ausführt. Ich denke, La Broue meint vielleicht diesen "waagerechten" Pinky-Push (im Gegensatz zum oben bisher immer gemeinten senkrechten mit senkrecht stehenden Reiterfäusten), wenn er von der jeu-de-paulme Bewgeung zur Erzielung der Courbette spricht.
Das Gegenteil, Versammlung, erzielt man dann im rechten Handgelenk durch Beugung desselben.
Update 21.April 2018:
Prizelius' Interpretation des Guerinieresitzs bringt höchste Harmonie in die Haltung des Reiters: seine leichte Supination der Gertenhand in Kombination mit der Beugung im Handgelenk führt auch zu einer leichten Annäherung der Haltung der Zügelhand an diese, nun tritt der Reiterbauch noch etwas weiter vor, die leicht geöffneten Hände bilden gefühlt ein Becken in das sich der Reiterbauch schmiegt. Die Rückenmuskulatur des Reiters entspannt sich erstmals ganz symmetrisch. Müsste man keine Hilfen geben, würde ich permanent in dieser Haltung auf dem Pferd sitzen!
Update 30. April 2018
Als mein Huforthopäde mich vor einigen Wochen darauf hinwies, dass der auf Picassos weißem, rechten Hinterhuf gut zu erkennende, horizontale, rötlich-bläuliche Streifen das Resultat eines Trittes durch den linken Hinterhuf war, wurde mir klar, dass ich die Rutschgefahr auf der nassen Wiese, deren Untergrund noch gefroren war, unterschätzt hatte. Bezeichnenderweise war diese Prellung beim Seitwärtsgalopp zur guten (rechten) Seite aufgetreten, deshalb gehe ich davon aus, dass ich obendrein zuviel Biegung im Hals, die zu seiner guten Seite ja sehr leicht auftritt, zugelassen hatte! Seitdem achte ich viel mehr auf La Broues Rat, im Seitwärts nur den Kopf etwas in Bewegungsrichtung zu stellen, aber nicht Hals und Rumpf des Pferdes zu biegen. (Gut, dass Picasso keine Eisen trägt!).
Durch die Gertenhandhaltung bei Prizelius bin ich nun wieder zur Gueriniers Gertenhand zurückgekommen, nachdem ich viele Monate andere Haltungen ausprobierte: senkt man die nach Prizelius gehaltene Gertenhand bei Bedarf abwärts, kann man dieselbe gute Reiterkörperhltung bewahren und bereit sein, notfalls in den Zügel greifen.
Zwischenbilanz Trensenkandare 21.05.2018:
Die starke Daueraufrichtung am ersten Tag des Trensenkandareneinsatzes ist nie wieder aufgetreten, ich vermute, sie kam zustande, weil zusätzlich zum unbekannten Maulgefühl vor der Halle rossige Stuten balgten und wir auch noch Frostwetter hatten.
Als ich vor 2 Wochen nach acht Wochen Trensenkandare wieder einmal die alte, ungebrochene, die ich seit vielen Jahren benutzte, angelegt hatte und einen Geländeausritt machte, war ein deutlicher Unterschied spürbar: das Pferd nahm keine ultrasanfte Daueranlehnung mehr, sondern wurde immer wieder mal eher hart abgestoßen: es legte sich deutlich mehr auf diese ungebrochene Stange, der Reiterarm ermüdete an diesem Tag deutlich mehr vom unangenehmen Ziehen des Pferdemauls am Zügel, als mit der Trensenkandare, und der Reiter wurde immer wieder aus seinem freien, unabhängigem Sitz gebracht.
Nach 11 Tagen Reitpause dann, und wieder mit der alten, ungebrochenen Kandare hatte Picasso sein altes Gleichgewicht wiedergefunden, das Ziehen an der Hand war verschwunden, und eine leichte Anlehnung wieder da. Diese deutlich andere Anlehnung nenne ich nun "über der Hand" weil sie im Gegensatz zu der der Trensenkandare nicht "in der Hand" (mit dem Gefühl einer direkten Verbindung in das Pferdemaul) liegt, sondern eher eine Vermeidung dieser darstellt. Ob die Ursache das dickere Mundstück mit Unterstützung durch die Lippen, oder der wesentlich längere Zügelweg ist, werde ich wohl erst herausfinden, wenn ich meine dritte Variante der einfachen Trensenkandare bekomme: eine mit ganz kurzen Unterbäumen wie auf dem Bild von Nestier.
Der Prototyp, den ich bis jetzt benutzt habe, hatte, wie sich herausstellte, eine viel zu hohe Zungenfreiheit: so scheint es mir nun, als wollte Gueriniere uns mit seiner Abbildung bewusst eine andere (Höchst-?)Variante zeigen als die damals für 140 Jahre bekannte La Broue Form (s. Übersetzung). Meine nächste wird die Zungenfreiheit von La Broue haben; weiterhin war mein bisheriger Prototyp eine gerade Ausführung, die nächste soll nun eine gebogene werden, die manchmal als S-Kandare bezeichnet wird: die Seitenteile exakt nach Gueriniere ausgeführt; dann erst kann ich sagen, wie sich die alten Reiter und ihre Pferde wirklich fühlten. Diese Art der Zäumung wurde für die schon etwas weiter ausgebildeten Pferde benutzt: zuvor wurden sie zuerst auf Kappzaum, dann mit zusätzlich angelegter gerader Trensenkandare zuerst ohne (wie eine Wassertrense), danach mit Kette, dann erst kam die gebogene Trensenkandare mit Kappzaum, danach diese solo. Je nach Fähigkeit von Pferd und Reiter waren natürlich verschiedene Zeiträume für die jeweiligen Stufen vorgesehen, die aber heutzutage vielleicht alle etwas verkürzt werden können, da wir heute für Vorbereitung und Begleitung des Trainings die derzeitige Blüte der Arbeit vom Boden aus erleben dürfen, die dem Pferd so Vieles schon klarmacht, bevor es zusätzlich vom Sattel aus die Übung erlernt.
Update 14.06.2018
Inzwischen bin ich mir sicher, dass die Einschätzung der allermeisten Reiter heutzutage, eine Wassertrense sei am besten für einen Anfänger und ein junges Pferd, eine Fehlinterpretation der alten Meister ist. Diese ist unter anderem dadurch entstanden, dass im Französischen inzwischen eine Wassertrense als „simple canon“ bezeichnet wird. Der Leser von La Broues und Guerinieres Texten erfährt ja, dass eine simple canon die schonendste und für das junge Pferd bestgeeignete Zäumung ist: damit war aber eine einfache Trensenkandare gemeint. Eine Wassertrense wurde von beiden für diese Fälle als ungeeignet angesehen, weil sie dazu führt, dass die Pferde sich auf Hand legen.
Andere Gründe haben natürlich auch dazu beigetragen: Hat der Reiter nicht gelernt, eine Parade mit dem Sitz durchzuführen, macht er dies mit der Gebisseinwirkung und schädigt sehr leicht die Anlehnung in das Maul, und womöglich das Maul selbst! Ein Parieren oder Wenden nur durch den Sitz in einer Rennsituation, z.B. einem Springparcours auf Zeit, ist ja sogar völlig unmöglich... Viele Reiter meinen, mit einer "kleinen" Wassertrense würden sie weniger Schaden anrichten.
Auch ist eine Wassertrense viel billiger zu produzieren, und hat nicht den Nachteil, dass man wegen langer Unterbäume das Pferd bei einer Rast nicht grasen lassen oder in flachen Wasser trinken lassen kann.
Da sehr viel von dem alten Wissen, wie man eine einfache Trensenkandare anpasst, verloren gegangen ist, bin ich sehr gespannt, ob wir es mit Hilfe der alten Bücher wieder zurückgewinnen können!
Update 11.Juli.18:
La Broues Übung der Passaden im ersten Band mit den gedoppelten Volten ist sehr schön zu reiten, und wohl wirklich eine gute Vorbereitung für im Seitwärts gerittene Demi-Volten, für deren Verbesserung ich noch immer keinen befriedigenden, weiterführenden Ansatz gefunden hatte: vielleicht geht es damit besser voran?
Erst nach einigen Tagen ist mir allerdings klar geworden, dass er die Anzahl der Volten mit zwei oder drei ungenau beschrieben hat: Man beginnt ja eine ganze, normale Volte auf einem Hufschlag (also ohne Seitwärts ), wenn die Vorderfüße des Pferdes am letzten Punkt der geraden Linie angekommen sind, mit dem Übertreten des äußeren Fußes über den inneren; dann reitet man eine ganze Volte und reitet weiter über diesen Startpunkt hinaus, bis man fast die Linie der Passade erreicht hat und beginnt, die Kruppe nach innen zu schwenken, damit Vorderfüße und Hinterfüße fast gleichzeitig auf der Linie ankommen, um sofort wieder geradeaus antreten zu können zum anderen Ende der Passade. Das sind dann aber nur eineinhalb Volten, noch einmal herum wären dann nur zweieinhalb und nicht drei Volten. La Broues Begriff „gedoppelte Volten (= doublierte Volten) bedeutet also in Wirklichkeit, dass nur die erste halbe Volte verdoppelt wird.
Pinky-Push Zwischenbilanz Update 13. Juli:
Der senkrechte Pinky-Push mit aufrecht stehenden Reiterfäusten hat mir über viele Monate sehr geholfen, mich vom Vorhandsitz auf einen Sitz in Mittelpositur zu bringen und die Vorhand des Pferdes zu entlasten mit vermehrtem Heben der Vorderbeine (Ich denke, das ist ein wichtiger Teil des „Leichtermachens“ des Pferdes (frz.:“allegrir“), wie es die Alten für erforderlich hielten). Dabei bleibt aber die Bewegung der Hinterbeine unbeeinflusst, es sei denn man übertreibt ihn, dann streckt sich das Pferd sogar, und es tritt eine Anti-Versammlung mit einer unerwünschten Absenkung des Rückens auf. Bei dem kurz gebauten Paco, der auch in Ruhe seine Hinterbeine nicht nach hin raus stellt, ist das kein großes Problem, aber Picasso tut genau dies immer (ich habe ihn deshalb sogar auf PSSM testen lassen!). Seit einigen Monaten wende ich den senkrechten Pinky-Push deshalb fast nur noch an, wenn die Pferde im Gelände nicht vorangehen wollen, z.B. auf den ersten paar hundert Metern vom Stall weg, oder wenn wir uns dem ungeliebten Schweinestall nähern.
Zum Versammeln aber, also zum vermehrten Untertreten der Hinterbeine, hat sich der „waagerechte“ Pinky-Push als sehr erfolgreich herausgestellt (waagerecht halten kann man die Fäuste allerdings nicht wirklich, die Supination ist ja nur bis ca.60° möglich, wenn man die Arme nicht ganz weit nach vorne halten will). Dabei werden zwar die Vorderbeine nicht ganz so stark aktiviert, aber die Vorhand wird trotzdem etwas erhoben und die Gesamtwirkung ist deutlich versammelnd.
Am schönsten und einfachsten gelingt auch dieser Pinky-Push, wenn man einhändig auf blanker Kandare reitet: mit zusätzlichen Kappzaumzügeln muss man sich sehr darauf konzentrieren, vor allem den Ringfinger deutlich nach vorn zu schieben.
Update 01.Aug. 18:
Eine ebenfalls exzellente Hilfe zur Verbesserung der Aufrichtung der Vorhand bei Reiter und Pferd ist die Gertenhaltung des Alten Fritz', hier zu sehen bei einer Porzellanfigur im Schloß Köpenick, Berlin

Update 23. Aug. 2018:
Endlich habe ich ein Wort für die Bewegung der Gertenfaust, die so fein und präzise die Hinterhand regiert: "Tamburinschwenk" (s. 3.3.2018).
Update 16.Sept.2018:
War ich anfangs erstaunt, einen wie geringen Durchmesser La Broues Volten an den Enden der Passaden mit ca. 3.50m haben, gelingen uns dank des Tamburin-Schwenks inzwischen noch viel kleinere: Zur Zeit galoppiere ich die Passade, lasse das Pferd an deren Ende fast zum Stehen kommen, während ich gleichzeitig die Schritt-Volte auf einem Hufschlag einleite, indem ich das Pferd den äußeren Vorderfuß über den inneren treten lasse. Mit voll nach innen tamburingeschwenkter Gertenhand engt sich das Pferd maximal ein und kann 1.50m Volten machen. Das Problem ist dann, dass ich im Rausch dieser kleinen Volte nicht bemerke, was dann schnell passiert, und erst, wenn das Pferd stehen bleibt, wird mir klar dass ich wieder einmal nur auf die schöne Bewegung der Vorhand geachtet, und dabei nicht gefühlt habe, dass die Hinterhand immer mehr hinein gewandert ist: dann ist sie inzwischen vor die Bewegung gekommen! Würde das Pferd nun weitergehen wollen, müsste es sein äußeren Beine hinter die inneren setzen, was sehr gefährlich ist. Also muss ich kurzzeitig den Tamburinschwenk reduzieren, das Pferd wird etwas weniger eng, die Hinterhand folgt wieder auf dem engen Kreis.
Update 13.10.18:
Es gibt keinen besseren Trainingsort für das Seitwärts als eine Reihe von früchtetragenden Apfelbäumen: sobald wir uns den Zweigen nähern, bemerkt man eine starke Steigerung der Körper- und Geistesspannung des Pferdes, es steht völlig ruhig da, reagiert äußerst genau auf meine Anforderungen: "Noch ein bisschen weiter seitwärts? Bitte!" "Gerne steige ich diesen trockenen Graben im Seitwärts herunter, parallel zu den Wänden!" immer in der fragenden Haltung: "Kommst so du dran?" Hier ist wohl die Bedeutung des Wortes "adverty" (= zugewandt), das La Broue so häufig benutzt, voll und ganz erfüllt!
Update 31.10.2018:
Seit vielen Jahren versuche ich meine Pferde unter der einhändigen Zügelführung ganz gerade
zu richten. In all den Jahren habe ich nur selten und nur für kurze Momente das Gefühl gehabt, hierbei wirklich erfolgreich zu sein. Weil bei dieser Zügelführung der Platz für die Zügelhand in der Mitte des Pferdes über dem Widerrist festgelegt ist, kann es ja keine Symmetrie des Reitersitzes geben. Das Beste, was man erreichen kann, ist ein Ausgleich dieser Asymmetrie (die sich ja voll auf das Pferd überträgt) , wie uns Eisenberg in seinen Bilden vermittelt: Der Reiter hält auf diesen seine Hände eher nebeneinander, wenn auch ein rechter Zügel, z.B. Kappzaumzügel mit der rechten Hand benutzt wird (beidhändige Zügelführung). Bei komplett einhändiger Zügelführung wird dagegen der Gertenhand sehr häufig hoch und eher über der Zügelhand, also auch fast in der Mitte über dem Widerrist getragen. Dies bringt auch mir meist das best erreichbare Gerade. Siehe Eisenberg:
L´art de monter à cheval ou description du manège moderne dans sa perfection : Stich 50 (L.) „L'AIMABLE“, Seite 102 im
http://www3.vetagro-sup.fr/bib/fondsancien/ouvonline/3288/3288.htm
Stich 36 (XXXVI) „LE GALANT“, auf Seite 74
Update 06.11.2018:
Heute wurde meine Gerte ein Opfer (auch) der Klimaüberhitzung: Bei 18°C und mit vollem Winterfell war Paco bei der Handarbeit heute so dickfellig und träge wie ein Eisbär. Bei der Aufforderung zur Schulparade bewgete er sich so wenig wie ein Stein: so kam es dass ich immer ungeduldiger wurde (ich war schon stressbeladen von zu Hause losgefahren) und einen etwas kräftigeren Touché benutzte: dabei brach die dünne Spitze nach nun fast genau einem Jahr ab! (s.06.03.18) .
Update 11.11.18:
Das stärkere Anheben der Vorhand im Galopp (s.19.01.18) übertragen meine Pferde zunehmend in die Handarbeit, und sie haben viel Spaß daran, sie immer höher zu nehmen (was im Sattel weiterhin eher als ein Zögern auf den etwas tieferen Hüften gelingt), wohl auch durch das Training des Levierens. Vor allem an der Hand nenne ich dies nun nach Ridinger „Relevierter Galopp auf den halben Hüften“ (Schul- und Campagnepferde, 1860, Stich Nr.18).
Update 27.11.18:
Das Kapitel 20 in La Broues zweitem Band , das ich gerade übersetze, hat mir soviel Zuversicht gegeben, dass ich heute mit beiden Pferden vier Passaden im mittleren Galopp mit zunehmend besseren Demi-Volten mit erhobener Vorhand geglückt sind, bei beiden Pferde die jeweils letzte ganz mit vier Schlägen. Dass es heute nur 2°C war, hat sicherlich geholfen. Ob dieses Erheben, wie Ridinger beschreibt, ein Herumwerfen des Pferdes auf der Hinterhand ist, oder ein Mezair im Seitwärts ist mir noch nicht klar, vielleicht dauert es auch noch, bis sich das sauber herausarbeitet. Ein sehr schönes Gefühl jedenfalls, diese Schwertkampfpassaden im Ansatz zu verstehen und machen zu können!
Update 31.12.18
Meine neuen Kandaren-Prototypen sind fertig: Die erste, die die alten Meister als mittlere Variante, die man zuerst benutzen soll, nachdem man ein junges Pferd zunächst mit einer geraden Kandare an diese Art der Zäumung gewöhnt hat, bezeichne ich als „Normal“, die zweite ist von dem Nestier Kupferstich abgeleitet, und die dritte ist eine mit einem längeren Unterbaum und einem hohen (90°) Bugabgang, was eine höhere Aufrichtung erzeugen soll.
Der Test mit der normalen über zwei Wochen war positiv, weil die Pferde das Mundstück (das bei allen drei Varianten genau gleich und sehr milde ist) gut annahmen, und anders (m.E. zufriedener) darauf kauen. Allerdings konnte ich keine höhere Aufrichtung, die eigentlich auch hier schon auftreten sollte, bemerken: dazu muss ich anmerken, dass ich eine Kandare immer äußerst vorsichtig einsetze, und von den alten ungebrochenen her immer noch häufiger fast kontaktlos reite als mit deutlicher Anlehnung. Auch die Beizäumung durch die Normale war eher so wie bei meinem vorherigen Prototypen einer geraden Trensenkandare, die Picasso schon seit vielen Monaten trägt. Aber schon bei etwas deutlicherer Anlehnung zeigte Picasso, mit seinem schlankeren, etwas längeren Hals, gelegentlich einen falschen Knick, der mich zunächst einmal davon abhält.
Seit drei Tagen benutze ich nun die extrem kurze und schwache (d.h.hinter der Bankettlinie) Nestierkandare: der Unterschied am ersten Tag war sehr stark zu spüren: Picasso trug die Nase genauso hoch wie einem akademischen Hackamore, er trat hinten weit heraus und er ließ sich im Trab nicht gut sitzen (aufgrund seiner steilen hinteren Fesseln). Allerdings waren anfangs auch die Kandarenhaken zu kurz und die Kinnkette rutschte von ihrem richtigen Platz zu weit nach oben. Heute, mit besser sitzender Kinnkette und schon etwas Gewöhnung, lief es sehr viel besser: ich wagte es, gelegentlich deutlich Anlehnung zu erzeugen, und hatte wohl auch deshalb eine deutliche, kontinuierliche Aufrichtung erzeugt?
Schon am dritten Tag mit der Normalen musste sich der neue Sicherungsmechanismus bewähren: als Picasso auf dem Rückweg in der Dämmerung im flachen Wasser trank, hatte ich zwar die langen Unterbäume, die sich zurücklegten, unter Beobachtung, dabei aber den linken Zügel nicht: als er darauf trat, scherte dann glücklicherweise der Sicherungssplint wie geplant ab, und weder Pferd noch Zügel oder Zaumzeug nahmen Schaden! Für so einen Fall hatte ich die Rosetten groß genug ausgeführt, um im Gelände den Zügel notfallmäßig hier einschnallen zu können.
Mein Plan ist es, die Nestierkandare 2 Wochen zu nutzen, und wenn ich dann die stark aufrichtende Kandare ganz fertiggestellt habe, direkt auf diese zu wechseln, um so den Unterschied bewerten zu können.
Für diejenigen, die sich auch selbst eine bauen, oder bauen lassen wollen, habe ich auf der Seite „Trensenkandare“ die jeweiligen Daten aufgelistet.
Falls jedoch ein größeres Interesse besteht, würde ich mich gern mit mehreren zusammentun für meine nächsten Typen!
 
Update 2. Jan. 2019
Nach der erstaunlichen Wirkung der Nestierkandare habe ich heute die „Normale“ 1.8cm hinter die Linie gebracht, indem ich sie einfach etwas nach hinten bog, dieses ergibt nur 2° hinter der Linie. Es hatte eine deutliche Auswirkung: beide Pferde nahmen im Gelände die Nase deutlich weiter nach vorn, konnten viel freier austreten, der Galopp war deutlich relevierter! Da wurde mir klar, dass die bisherigen, ungebrochenen Kandaren nur vorgaben, schwach und hinter der Linie zu sein, was ich wegen der rückbiegigen Unterbäume natürlich als gegeben annahm! Tatsächlich sind diese aber mindestens mittelhart, wie ich jetzt weiß! Weil ich mit ihnen nie richtig zufrieden war, hatte ich beide Pferde zweimal für jeweils drei Monate mit dem akademischen Hackamore geritten, dies aber wieder aufgegeben, da es den Reitersitz verschlechtert und erhebliche Kraftaufwendung erfordert, und selbst dann keine gute Beizäumung erzielen kann. So musste ich mich darauf beschränken, mit den ungebrochenen Kandaren fast immer mit durchhängenden Zügeln zu reiten.
Mit dieser neuen, durch das Zurückbiegen nun etwas schwächer beizäumenden Kandaren ist für mich nun erstmals richtiges Reiten möglich: nun kann ich den Grad der Beizäumung frei wählen! Im Gelände und freiem Schritt wenig, in der Versammlung viel. Dieses „viel“ kann ich nun der engen Ganasche von Paco und dem schwachen Maul von Picasso entsprechend sehr fein variieren! Es geht voran!
Update 05.Jan.19
Die schwachen Trensenkandaren halten, was sie versprachen: die Pferde können nun den Kopf frei anheben, und ich weiß jetzt, dass ich all die Jahre mit meinen Versuchen, auf vielerlei Weise den Kopf von Picasso anzuheben, scheitern musste: die alten Kandaren verhinderten dies komplett, die Pferde „nahmen den Kopf zwischen die Beine“ ! Ich kann nun, nach nur zwei Tagen mit der Normalen, die 1.8cm hinter der Bankettlinie ist, meine Zügelhand schon eine Handbreit absenken. Die Aufrichtung der Vorhand kann jetzt überhaupt erst stattfinden, weil das Pferd nun den Kopf anheben kann, und sie wird unterstützt durch den 45° Bugabgang, wenn man die Zügel ultrasanft annimmt: ich bin überglücklich!
Update 06.01.2019
Erstmals seit Beginn meines Seitwärts-Trainings vor sehr vielen Monaten hatte Picasso dabei heute in der Halle eine Aufrichtung! Weil diese Aufrichtung der Vorhand eine unabdingliche Voraussetzung für das Setzen auf die Hüften ist, und die alten Kandaren diese verhinderten, hatte ich heute zum ersten Mal das Gefühl: so wird es richtig! Zuvor habe ich alles erdenkliche probiert, um die Art Versammlung zu erzeugen, die man auf den Guerinierebildern sieht: mal ein Touchée auf die Kruppe, mal ein Touchée an das Maul von unten: aber alles brachte nur für einen halben bis ganzen Schritt eine etwas mühsame Aufrichtung, die sofort wieder verschwand. Der versammelte Galopp in der Halle ist ebenfalls sehr verändert, und zwar so stark, dass er, obwohl ich dreimal versuchte, Picasso zu einem mehr ausgreifenden und schnelleren Galopp zu bringen, nicht ein bisschen darauf reagierte, weil er ja nur selten in seinem Leben mit erhobenem Kopf in Aufrichtung galoppiert war, und mich nicht verstehen konnte. Es geht nun richtig voran!
Update 19.Jan.2019
Schon wieder ein unfreiwilliger Kandarentest!
Als ich mit Picasso im Gelände war, begegneten wir einer Frau mit zwei nicht angeleinten Bull-Terriern. Als die Hunde uns bemerkten, begannen sie auf uns zu zu rennen. Die Besitzerin hätte den größeren wohl mit einem herzhaften Griff ans Halsband zurückhalten können, hielt aber in der Bewegung inne (vielleicht hatte sie Angst, gebissen zu werden?). Ich überlegte natürlich angesichts zweier sehr bedrohlich wirkender Kampfhunde, davon zu galoppieren, aber rechts war ein tiefer, überwachsener Graben, links ein schwerbödiger Acker, geradeaus wäre die Hundebesitzerin wahrscheinlich empört gewesen, wenn ich dicht an ihr in vollem Galopp vorbeigezogen wäre, und bei einer nicht ganz kurzen Flucht wären wir auch überall auf Teerstraßen mit dem entsprechenden Rutschrisiko gestoßen… Also blieb ich, und als die Hunde sehr dicht kamen, versuchte ich sie mit Rufen zu verscheuchen: null Reaktion! Dann versuchte ich den Hund auf meiner rechten Seite mit meiner Gerte einzuschüchtern (leider ist das eher ein Stöckchen) und der Hund reagierte wieder überhaupt nicht, sondern umkreiste uns weiter. Dann versuchte ich den etwas kleineren Hund auf meiner linken Seite zu erreichen, aber die Gerte in meiner rechten Hand war hier viel zu kurz, und in dem Moment, als mich zur linken Seite weiter herunter beugte, machte der Hund einen Satz auf uns zu und Picasso sprang nach rechts, was mich aus dem Sattel holte. Anfangs hatte ich die Zügel noch in der Hand, aber der Hund setzte sofort nach, sodass Picasso mir die Zügel aus der Hand riss und fort galoppiert. Die Hunde hetzte ihn noch ca. einen halben Kilometer, auch an der Straße entlang. Nicht auszudenken, was zwei Tage später passiert wäre, als die Brücke spiegelglatt gefroren war!
Erst beim nächsten Aufzäumen (Picasso war bei seinem Eintreffen auf dem Hof von freundlichen Helfern abgetrenst worden, als er allein nach Hause kam) bemerkte ich, dass die Unterbäume der normalen Trensenkandare auf beiden Seiten verbogen waren. Sie ließen sich relativ leicht mit der Hand in eine passable Form zurückbiegen (für eine Rückkehr aus dem Gelände hätte das so ausgereicht), und dann im Schraubstock ebenso leicht vollständig wieder herrichten. Weil ich meine, dass in so einem Notfall durch das Verbiegen zumindest ein wenig Druck vom Pferdemaul genommen wird, werde ich die Seitenteile nicht verstärken (für den normalen Längsdruck beim Zügelanziehen ist sie ja stark genug gebaut).
07.02.2019 Dritte Zäsur meiner Reitentwicklung
Seitdem meine neuen Kandaren alle bisher von mir benutzten „rückbiegigen“ als fehlkonstruiert entlarvt haben, wird zunehmend deutlicher, dass dies eine dritte große Zäsur in meiner Reiterei geworden ist. Die erste war die Lektüre von Bents Buch „Akademische Reitkunst für den anspruchsvollen Freizeitreiter“, nach der ich wusste:“Dies ist die richtige Reitweise für mich!“; die zweite die Entdeckung der vielen Vorteile des Guerinieresitzes: ab diesem Zeitpunkt sagte ich von mir: „Jetzt kann ich reiten!“ Seit meine Pferde nun die neuen, wahrhaftig schwachen Kandaren tragen, sage ich: „Jetzt erlaubt die Zäumung meinen Pferden endlich eine akademische Haltung!“ Sie heben die Vorderbeine viel mehr und raumgreifender, liegen nicht mehr auf der Vorhand, Picassos Trab ist wesentlich weicher geworden, der Galopp hat sich verbessert, und das Seitwärts so sehr, dass Picasso heute bei der Handarbeit im Seitwärts mit der Nestier-Trensenkandare sein äußeres Vorderbein in demselben extrem hohen Bogen über das innere führte, wie die Stiche von Gueriniere es zeigen. Insgesamt vermitteln sie viel mehr den Eindruck, „freie Pferde“ zu sein. Pacos Angaloppieren fühlt sich jetzt so mächtig an, wie die Carriere von La Broues Pferd auf der Titelseite meiner Übersetzung. Häufig denke ich nun, dass jetzt der spanische Anteil der Knabstrupper sichtbar wird! Ich hoffe sehr, bald auch ein richtiges, tiefes Terre-A-Terre entwickeln zu können, denn sehr wahrscheinlich wurde dies bisher durch die falschen Kandaren verhindert.
Aufgrund der viel sanfteren Mundstücke kann ich inzwischen richtig mit dem Pferdemaul verhandeln, weil nicht mehr jedes Anziehen der Zügel gleich zur Abwehr führt, und es lassen sich viele verschiedene Grade der Anlehnung variieren.
Weil die neuen Trensenkandaren nun endlich dem Genick des Pferdes gestatten, hoch zu kommen, und nur die Nase, aber nicht den ganzen Kopf des Pferdes herunterbringen, taucht jetzt erstmals bei meinen Pferden die Frage auf: wie viel Aufrichtung der Vorhand/des Genicks möchte ich/darf ich zulassen/ brauche ich? Und wann bzw. in welcher Übung?
La Broue benennt die beiden für die versammelnden Lektionen unerwünschten Kopfhaltungen: erstens, wenn das Pferd die Nase im Wind hat, bzw. wenn Nase und Ohren des Pferdes auf gleicher Höhe sind; zweitens, wenn das Kinn des Pferdes auf seiner Brust ankommt. Er wünscht sich, dass „das Pferd Kopf und Hals in seiner mittleren und schönsten Haltung trägt“. Zur Zeit glaube ich, dass in der hohen Versammlung in Schritt und Trab die schönste Haltung meiner beiden meistens in der Gegend von 10-20° vor der Senkrechten liegt (beim Erheben der Vorhand natürlich mehr). Diese Haltung ergibt sich auch mit der ganz schwachen Nestierkandare.
Ich möchte, dass eine hohe Aufrichtung der Vorhand es der Hinterhand ermöglicht, sich abzusenken durch vermehrtes Vorwärtstreten der Hinterbeine unter den Pferdebauch. Einen starken Druck auf die Ohrspeicheldrüsen des Pferdes im Spalt hinter den Ganaschenknochen sollte man nicht zulassen und muss darum die Kandarenform, aber auch die Art und Weise ihrer Benutzung der anatomischen Beschaffenheit dieses Spaltes beim jeweiligen Pferd anpassen. Aus diesem Grunde möchte ich eine starke, andauernde Zugwirkung der Unterbäume nach hinten vermeiden: das Pferd soll seine Haltung zwanglos einnehmen.
Da ich immer noch vollauf mit der Evaluation der Nestier- und der „Normalen“ Kandare beschäftigt und überglücklich über die Super-Aufrichtung schon mit diesen beiden bin, habe ich die „Hohe Aufrichtung“ immer noch nicht fertiggestellt. Im Moment könnte ich mir sogar vorstellen, dass zukünftig verschiedene Varianten der Nestierkandare der Mainstream für die allermeisten Reiter werden könnte, doch wer weiß was ich noch herausfinden werde?
Update 23.02.19: Konstruktionsmanko bei meiner Nestierkandare
Beim gestrigen Ausritt bemerkte ich eine Veränderung in Pacos versammeltem Galopp bei Versuch ein Terre-A-Terre zu erzeugen, und nach dem Durchparieren sah ich, dass an seine Nestierkandare rechts beide (!) Ketten herab hingen, und das kam so:
Paco gehört zu den Pferden, die einen so starken Rücken haben (s. La Broue, Bd.II, Kap 23), dass sie sich beim ersten Angaloppieren immer zunächst ein bis dreimal schütteln müssen: er macht das, indem er die Vorhand etwas höher nimmt und dabei schlangengleich den Hals und Kopf windet. Gelegentlich wirft er dabei den (bzw. bei zusätzlichem Kappzaum: die) rechten Zügel über den Kopf auf die linke Seite, sodass plötzlich beide (bzw. alle vier) Zügel auf der linken Halsseite sind. Bei den alten, zu starken Kandaren warf er häufig den Kopf derart nach oben, dass die Kandarenunterbäume nach oben (!) kamen: die Kette war dann überhaupt nicht mehr wirksam, und ein Zügelanzug führte dann dazu, dass er seine Nase und Kopf höher brachte anstatt tiefer. Nicht selten löst sich auch die Kinnkette aus dem dem Kinnkettenhaken und hängt dann nutzlos herab, und dies war gestern auch passiert. Wenn die Kinnkette nicht mehr da ist, fällt die Kandare durch, das heißt, beim Zügelanzug wandern die Unterbäume ganz nach hinten in Richtung Reiter. Ein paar Tage vorher hatte ich noch einmal probiert, ob auch dünnere Sicherungssplinte ausreichen könnten, und leider vergessen, nach dem letzten Versuch den schon mit sehr starker Zugkraft getesteten Splint auszutauschen. Weil nun der Zügelanzug die Zugrichtung genau auf den geschwächten Splint lenkte, brach dieser, und der Kloben mit dem Zügelring rutschte heraus. Die Schaumkette, die bei diesem Prototypen einfach über den Klobenstift geworfen wird, verlor damit den Halt und hing nun ebenfalls herunter!
Zum Weiterreiten befestigt ich dann die Zügelschnalle direkt in der Rosette, bemerkte aber glücklicherweise nach dem Einhaken der Kinnkette, dass dieses zum Einwärtsbewegen der Oberbäume in Richtung Zähne führte (die Schaumkette, die dazu da ist, genau dies zu verhinder, hing ja nutzlos herab). So entschloss ich mich, die Kinnkette wieder auszuhängen und ritt so nach Hause, das Mundstück praktisch als reine Trense benutzend.
Diese Konstruktion hatte sich sowieso schon als unbefriedigend herausgestellt, weil die Rotation der Kloben, die eigentlich die Zügel ausdrehen soll, zum Eindrehen der Kinnkette führt, welche sich dann wieder zurückdreht, sodass man häufig mit in sich verdrehten Zügeln reitet.
Update 24.03.2019
Seit zwei Wochen habe ich die Trensenkandare mit den langen Unterbäumen, die ich „Hohe Aufrichtung“ getauft hatte, in Gebrauch. Bei dieser habe ich von vornherein das Klobenloch 2.5cm hinter die Linie des Banketts zurückgebracht, das entspricht ca. 5°.
Der erste Eindruck einer sehr komfortablen, sehr ruhigen Zügelführung hat sich bis heute bestätigt, die Pferde sind gelassener und gleichmäßiger, die Kandare fühlt sich sanft an.
(Ein Konstruktionsmanko ist die Positionierung der oberen Schaumkette, deren Höhe ich Π x Daumen festlegte, und die nun sehr dicht am Pferdemaul ist, was die Pferde allerdings nicht im Mindesten stört).
Die Pferde versammeln sich mit dieser Kandare leichter und besser, ohne ein betontes Anziehen der Zügel, und so ist wohl der Begriff „höhere Aufrichtung“ nicht so zu verstehen, dass man durch Anziehen der Zügel mit einer Rotation des Buges das Genick des Pferdes nach oben schiebt, wie ich gedacht hatte, sondern es kommt zu einem vermehrten Untertreten der Hinterfüße bei einem weiter vor- und höher Treten der Vorderbeine, was ein Leichterwerden der Vorhand bewirkt.
Diese ist bei weitem meine Lieblings-Trensenkandare geworden! In einigen Wochen werde ich sie variieren, indem ich das Klobenloch noch weiter hinter die Linie bringe, auf insgesamt 5cm.
Update 02.April 2019
Je länger ich erhobenen Demi-Volten (mit Demi-Courbetten (=Mezair) bzw. Courbetten) zu trainieren versuche, wird mir immer klarer, wie wichtig es ist, sich diese NICHT als Hinterhandwendung vorzustellen: nur wenn man vom Pferd ausdrücklich verlangt, mit den Hinterbeinen wirklich einen kleinen Kreis im Seitwärts zu gehen/zu springen, bleibt das Pferd in der Lektion, d.h. es fällt nicht plötzlich aus dem Takt und aus der Bewegungsrichtung.
Erzielt man allerdings eine korrekte Demi-Volte, fällt es im Seitwärts-Schritt auf der Demi-Volte sogar immer wieder mal von allein in einen Galoppsprung/Terre-a-Terre-Sprung seitwärts, was als Vorstufe zum erhobenen Seitwärts durchaus begrüßenswert ist, und wenn man danach einen sehr kleinen Zirkel galoppieren möchte, fällt es sehr viel eher mal in einen sehr versammelten Schulgalopp mit einer sehr engen Wendung von 1 bis 2m Durchmesser des Kreises der Hinterhand.
Weil ich so viele Jahre lang Carrees und „eckige“ Volten gleichgesetzt hatte, und deren Ecken als Hinterhandwendung auf der Stelle gedacht und verlangt hatte, muss ich mich nun immer wieder sehr darauf konzentrieren, den kleinen Kreis zu verlangen und durchzuhalten. Eine Ursache für meinen Fehler ist auch eine ungenaue Zeichnung bei Gueriniere: Auf dem Stich „Les Voltes“ sieht man oben die Carrees, die er wirklich mit Hinterhandwendungen in den Ecken ausführt, bei denen die Hinterhand auf der Stelle bleibt. Bei den „Voltes ordinaires“ (den normalen Volten) werden zwar die verschiedenen Stellungen der Hinterfüße ganz gut dargestellt, aber nicht die Linie, die diese beim Seitwärts-Durchschreiten der Ecken beschreiben, denn diese ist in Wirklichkeit ein kleiner Viertelkreis, passend zu dem korrekt gezeichneten großen Viertelkreis der Vorderfüße.
So sollte man die „volte ordinaire“ vielleicht besser nicht mit „eckige Volte“ bezeichnen, denn ihre „Ecken“ sind ja deutlich abgerundet; besser wäre vielleicht, sie „Volte mit geraden Seiten“ oder „quadratische Volte“ zu nennen? (Das wäre dann wirklich die angeblich unmögliche „Quadratur des Kreises".. )
Hat man beim Reiten Guerinieres Zeichnung der volte ordinaire im Kopf, reitet man eher „die Figur“ (Hinterbeine entlang der Linie), denkt man sich dagegen die Ecken als rund im Seitwärts reitet man eher „die Lektion“.
Wenn das Pferd diesen kleinen Kreis der Hinterhand in der (Demi-)Volte verfälscht und in Richtung Hinterhandwendung zurück kriecht, bezeichnen La Broue und seine Nachfolger dies als „acculer“ (einengen, verengen, verkleinern), für das ich noch keine gute deutsche Entsprechung gefunden habe. Vielleicht sollten wir auch dieses Wort einfach aus dem Französischen in unsere akademische Sprache übernehmen? > „Nicht accülieren!“
Um die Wichtigkeit dieses kleinen Innenkreises der Hinterfüße hervorzuheben, halte ich z.B. die Bezeichnung „Basiskreis“ für angemessen. Dann könnte man auch sagen: „Achtung, nicht die Basis verlieren!“
Update 13.April 2019
Die Trensenkandare „Hohe Aufrichtung“ ist zu schwach gebaut, auf Dauer verziehen sich die langen Unterbäume, der Edelstahl ist weich und zäh. Biegt man sie zu oft in ihre richtige Position zurück, wird es sicher irgendwann einen Ermüdungsbruch geben. Ich werde sie verstärken müssen.
Möglicherweise verdient diese Kandare ihren Namen nur bei Pferden, die eine ideale Ganasche haben. In seinem Dictionnaire definiert Garsault die Ganasche als „die Rinne zwischen den beiden Ganaschenknochen, den dicken Ausläufern der Unterkieferleisten.“ Ein Pferd könne umso schlechter beigezäumt werden, je enger die Ganasche ist.
Habe bei Garsault wieder einmal gelesen, wie der Kunstreiter die Zügel nachgeben soll, und diesen Rat endlich ernst genommen: Der Reiter greift das Ende der Zügel mit der Gertenhand, gibt die Zügel in der Zügelhand frei und lässt die Gertenhand auf den Hals des Pferdes sinken. Hierbei bemerkt man sofort eine Entspannung in der Längsachse des Pferdes, dessen Körperhaltung durch den asymmetrischen Sitz bei der einhändigen Zügelführung vorher asymmetrisch war.
Dies bekräftigt meine Ansicht, dass es von einigem Nutzen ist, jeden Tag den Sitz zu wechsel: einen Tag den Rechtshändersitz, den nächsten den Linkhändersitz, um eine gleichmäßigere Gymnastizierung (von Pferd und Reiter) zu erreichen.
Update Ostern 2019: Der vollkommene Sitz
Wenn man immer mal wieder die Gerte nach unten trägt und die Gertenhand so dreht, wie es der alte Fritz zeigt, bekommt man ein gutes Gefühl für den richtigen Vorschub von Becken und Bauch des Reiters. Nach ein paar Wochen braucht man sich dann diese Handdrehung nur noch vorzustellen, bei aufrecht getragener Gerte, um den selben Effekt zu erzielen. Irgendwann erreicht man dann, bei einer Beinhaltung etwas vor dem Pferd und Handhaltung annähernd wie bei Prizelius (etwas supinierte und etwas im Handgelenk gebeugte Hände) den vollkommenen Reitersitz: nun hat sich das Brustbein des Reiters seinem Kinn angenähert und die Wirbelsäule steht genau richtig, und der Reiter fühlt sich wie ein hoher Herr mit einer entsprechend gravitätischen Ausstrahlung auch in sein Inneres, was eine äußerst hohe Zufriedenheit bei ihm bewirkt! Der Reiter würde in dieser Haltung auch beim Tanz eines Menuetts eine gute Figur machen!
Ich bin gespannt, ob ich es irgendwann schaffen werde, in jeder Reitsituation in diesem ungewohnten Sitz zu bleiben, denn meine normale Körperhaltung außerhalb des Sattels ist dies ja nicht; vielleicht ändert auch diese sich dann zum Vorteil?
Update 26.04.19
Weil ich die Trensenkandare mit den langen Unterbäumen erst verstärken muss, habe ich heute wieder bei Picasso (Paco ist für ein paar Wochen zum Deckeinsatz verreist) die mittellange, die ich "Normal" getauft hatte, benutzt. Der Unterschied war sehr deutlich zu spüren: Picasso spielt immer sehr viel mit dem Mundstück, und mit diesen kürzeren Unterbäumen kam jede Bewegung des Maules deutlich als Zug in meiner Hand an. Im Galopp musste ich zur Schonung des Mauls sogar bei jedem Sprung deutlich mit der Hand mitgehen, anstatt sie ruhig über dem Widerrist stehen lassen zu können: es stimmt also, was die alten Meister, u.a. Solleysel, immer wieder schreiben: je kürzer der Unterbaum, desto gröber die Einwirkung! Erst nach mehr als 30min hatten wir beide uns halbwegs daran gewöhnt!
Update 06.07.19: Der stolze Sitz
Den vollkommenen Sitz nenne ich seit einiger Zeit "stolzer Sitz", womit ich ihn sehr gut beschrieben finde.
Wenn der Reiter ihn anwendet, scheint ihm, er drücke damit für sich selbst, aber auch für sein Pferd und auch für die Menschen, denen er begegnet, eine besondere Wichtigkeit, eine besondere Bedeutung oder gesellschaftliche Stellung aus, was dazu führt, dass es dem Reiter tatsächlich so vorkommt, als sei das Reiten selbst zweit- oder gar drittrangig, und werde so nebenbei erledigt. Er fühlt sich wie auf einem Pferd, das ihn auf kleinste Hilfen hin dahin bringt, wohin er möchte, in allen Gangarten ganz ruhig, wendig, und das bei Bedarf auch mal repräsentativ seine Vorhand erhebt. Die Betonung liegt hier auf dem Wörtchen "auf", denn nun lässt er sich herrschaftlich tragen, sitzt fast schon über seinem Pferd, im vollen Vertrauen darauf, dass es keine Dummheiten machen wird, und selbst wenn, er so sicher ist, dass ihm nichts passieren wird.
Hierbei muss der Reiter aufpassen, dass er nicht affektiert wirkt, sondern dass alles ganz natürlich aussieht, wie alle alten Lehrmeister fordern.
Für diese Haltung zu Pferde ist einerseits sehr viel Vertrauen zum Pferd nötig, andererseits wird dieses Vertrauen produziert und um so mehr gestärkt, je häufiger und in je verschiedenartigeren Situationen man sie anwendet.
Update 26.10.19: Signaturlektion La Broues
Meine Lieblingsübung ist die auf den ersten acht Skizzen des Kapitels 33 im zweiten Band La Broues: Hiermit zeigt er, dass er nicht nur ein hervorragender Pferdepädoge war, sondern auch ein glänzender Didaktiker für die Menschen, denn dieses Kapitel hat er strategisch sehr gut platziert: wie er erklärt, sind diese ersten 8 Skizzenist nicht nur in der weit fortgeschrittenen Ausbildung, sondern auch schon an deren Anfang einsetzbar. Er wusste, dass der anspruchsvolle, wissbegierige Reiter seine Bücher beim ersten Lesen in Windeseile verschlingen, und dann fast am Ende der beiden Ausbildungsbände auf diese Lektion stoßen würde, gerade dann, wenn er beginnen wollte „richtig einzusteigen“ in die Ausbildung nach La Broue und Pignatelli. Hätte ich die Bücher nicht so sehr langsam über Jahre, sondern innerhalb weniger Wochen in den Grundzügen verstehen können, hätten wir, meine Pferde und ich,vielleicht nicht zunächst die „passade en pirouette“ mit einer Wendung auf der Hinterhand in zwei bis drei Mezair-Schlägen erarbeitet (die man vielleicht als „nur“ eine Kampfmanege bezeichnen könnte), sondern von Anfang an nur danach gestrebt, dies nach der „vraye escole“, der wahren Schule, in drei Courbetten oder Croupaden oder Kapriolen mit einem Innenkreis zu erlernen.
Diese Übungen erklären beiden, dem Pferd und dem Reiter sehr schön, dass, und wie man diesen Innenkreis erzielen soll und kann, und dass ein Seitwärts auf einer Volte aus zwei Hauptbewegungen, die beim Fortschritt immer mehr ineinander verschmelzen, zusammengesetzt ist.
Für mich ist dies die Signatur-Lektion La Broues, die sein überragendes Verständnis für die geistigen und körperlichen Lernprozesse bei Reiter und Pferd am deutlichsten von allen Lektionen zeigt, und wäre ich Reitlehrer, würde ich die erste der vier Skizzen in Nr 7 als Emblem meiner Reitschule wählen. Übrigens hat La Broue diese Lektion erst nach Erscheinen der ersten Ausgabe in 1593 entwickelt, in dieser waren die Skizzen zwei bis acht nicht enthalten.
Update 29.10./03.11.19
Das akademische Nachgeben der Zügel (siehe 13.April 19) hat sich als wichtiger Bestandteil meiner Reiteinheiten eingefügt. Wenn man es auf einer geraden Strecke im Gelände nutzt, fühlt man genau, wie sich das Pferd aus der Zügelhandbiegung über die gerade Haltung in die Gertenhandbiegung (die ja jetzt zusätzlich die neue Zügelhand ist) umstellt: die Kruppe wandert von der Zügelhandseite zur Gertenhandseite; weil dann aber das Pferd am hingegebenen Zügel geht, kommt die Kruppe nicht so weit herüber wie in der Versammlung.
Als ich dies zum ersten Mal mit Picasso auf unserer etwas ansteigenden Galoppstrecke tat, schoss Picasso völlig unvermutet zwei gestreckte Galoppsprünge vorwärts: es fühlte sich an wie ein Durchgehen, und erst als die Gertenhand mit den Zügeln über dem Widerrist ankam, wurde er wieder langsamer. Dies zeigte mir am deutlichsten, wie sehr die Kruppe durch die einhändige Zügelführung in Unterordnung gehalten wird (wie La Broue es ausdrücken würde). Auf einem 40minütigen Ausritt ist das schon eine sehr lange einseitige Belastung von Skelett und Muskulatur!
Es erklärt übrigens auch, warum sich der Tambourinschwenk zur Zügelhandseite mächtiger anfühlt als zur Gertenseite: zur Zügelhandseite hin ist die Kruppe ja schon 10° vorgeschwenkt: füge ich nun 15° hinzu sind die 25° sehr deutl zu erkennen; auf der Gertenhandseite startet man aber mit -10°: füge ich nun 15° hinzu lande ich bei 5° , habe dann also nur etwas mehr als geradegerichtet!
Inzwischen reite ich so, dass ich die Zügelhand meist nur noch während der eigentlichen Übung einsetze und danach sofort akademisch nachgebe. Auf diese Weise wird die Gegenseite des Pferdes zwar nicht ganz im selben Maße trainiert, aber immerhin gibt es eine deutlich Entlastung der Zügelhandseite. Je nach Energiezustand des Reiters und/oder des Pferdes benutze ich z.B. jetzt die Zügelhand im Gelände nur noch für ca. 30-50% der Zeit.
Aus dem Seitenwechsel der Kruppe beim akademischen Nachgeben entsteht übrigens eine interessante Frage: wenn das Pferd im Linksgalopp die Kruppe mehr nach rechts nimmt, ist das ja kein Außengalopp. Eigentlich müssten wir hierfür ein ganz neues Wort erfinden: S-Galopp vielleicht (weil der Pferderücken dabei S-förmig gebogen ist, oder weil er schlangenförmig gebogen ist ). Und wir müssten uns natürlich klar werden darüber, ob er schädlich ist, zumindest auf längere Dauer sicherlich nicht!
Auch über die Auswirkung in den anderen Gangarten lohnt eine Diskussion sicherlich: wenn man mit der Zügelhand außen reitet, ist ja die Kruppe weniger stark innen, als wenn die Zügelhand innen ist.
Im Moment bin ich deshalb der Ansicht, dass ein wichtiger Grund für Gueriniere und Nestier, beim Reiten auf der rechten Hand den rechten Zügel mit der Gertenhand zu ergreifen, das Geraderichten/Anpassen der Kruppe, also das Verhindern oder zumindest Vermindern einer S-Form im Rücken des Pferdes durch den dadurch veränderten, etwas symmetrischer einwirkenden Sitz des Reiters ist: es ging ihnen also gar nicht nur darum, die Biegung des Halses durch Anziehen des rechten Zügels zu erreichen, sondern durch Annehmen des rechten Zügels eine Veränderung der Asymmetrie im Reiterrücken zu erzeugen, die bei Erfolg zu einer Entlastung des linken und dadurch zu vermehrter Belastung des rechten Sitzknochens führt. Hierdurch schwenkt die Kruppe nach rechts, was beim Reiten auf der rechten Hand zur erwünschten durchgehenden Rechtsbiegung führt.Die Gertenhand muss dazu deutlich tiefer gestellt werden, weil sonst die rechte Reiterschulter hoch wandert.
Als ich das erste Mal einhändig ritt, jubelte ich, weil sich das Pferd „von allein“ versammelte, aber so schön es ist, dass bei einhändiger Zügelführung immer automatisch eine leichte Versammlung auftritt, die ein zu starkes „Durchgehen“ etwas verhindert/reduziert, war dies leider bei mir in der Vergangenheit noch ein weiterer Bremsfaktor: zusätzlich zu dem falschen Sitz auf der Vorhand mit pronierten Händen, abgerundeten Schultern, häufigem Blick des Reiters nach unten, und dem unsicheren Sitz durch die Haltung der Beine hinter dem Pferd, und obendrein den falschen Kandaren, die meinen Pferden „den Kopf zwischen die Beine zogen“! Kein Wunder, dass ich einen ständig klopfenden Schenkel hatte: sonst wäre das Pferd ja zweifellos stehengeblieben!
Weil ich mir deshalb auch angewöhnte, fast immer mit eher durchhängenden Zügeln zu reiten, wird es es jetzt, wo eine Aufrichtung des Pferdes möglich ist, sehr schwer, mich umzugewöhnen: eigentlich hatte ich ja gehofft, auch ohne Anlehnung weiter zu kommen, aber so ist die Hilfengebung mit der Zügelhand doch viel zu ungenau und schwammig, um höhere Lektionen sauber reiten zu können.
Update 16.11.19
Endlich ist ein korrektes Seitwärts möglich: Bisher hatte ich nie einen Spiegel zur Verfügung, und immer das sichere Gefühl, dass meine Pferde beim Seitwärts immer wieder mit der Hinterhand zurückblieben, was häufig dazu führte, dass nur eine Phase auf zwei, die andere aber immer wieder auf drei Beinen ausgeführt wurde, also fehlerhaft war. Seit einigen Tagen kann ich nun über 10m Länge mein Spiegelbild sehen, und viel besser Korrekturen anwenden. Zusammen mit der Anwendung des Gueriniere‘schen Greifens in den Gertenhandzügel, bzw einem deutlichen Tambourinschwenk, kommt nun endlich, nach all den Monaten zustande, eine gleichmäßiges Seitwärts, bei dem das Pferd niemals drei Beine gleichzeitig auf dem Boden hat! Das Pferd erhebt nun auch wie gewünscht gelegentlich nach drei oder vier Schritten im Seitwärts einmal von sich aus die Vorhand. Nun stellt sich heraus, dass man das Seitwärts sogar als 85° Abstellung, anders ausgedrückt also zwischen 80° und 90°, denken muss, d.h. der größere Fehler ist eine zu geringe Abstellung von z.B.70°!
Das bedeutet, dass man zwar nach Gueriniere zum Anfang der Ausbildung im Seitwärts, falls man die Hilfe einer Wand benutzen muss/möchte, zunächst das Seitwärts als Croupe-au-Mur trainieren soll, dann aber, wenn man soweit ist, dass man das Pferd immer mindestens 1.5m von der Wand entfernt halten kann (um einen Kronentritt zu vermeiden), man unbedingt die Bewegung in einem Spiegel kontrollieren muss, also das Pferd mit dem Kopf zum Spiegel (also zur Wand) stellen muss!
Update 28.11.19:
Seit ich mit Hilfe des Spiegels einige Male kontrollieren konnte, wie ein richtiges Seitwärts produzierbar ist, fühle ich mich dabei jetzt wie Fiaschi, der 1556 diese Übung als so wichtig ansah, dass er sie als Einleitung seines zweiten Bandes, in dem er die Reitübungen beschrieb, auserkor:
Sie ist die Grundvoraussetzung für die Ausbildung eines wirklich wendigen Pferdes und damit für die akademische Reitkunst, die ja u.a. auf dieser Wendigkeit aufbaut. Inzwischen ist klar, dass die Abstellung des Pferdes nicht exakt auf 85° bleiben kann, sondern durch die jeweiligen Bewegungen der Schulter und der Kruppe immer schwankt: 80° bis 95° scheinen dabei akzeptabel zu sein, ohne dass der Zweitakt verloren geht.
Auch wenn ich noch nicht genau die Zeitpunkte fühlen und festlegen kann, bekomme ich doch jetzt den Eindruck, dass Cavendish wirklich recht haben könnte mit dem Satz: „Wenn dabei die Vorhand weit ist, ist dies ein Terre-a-Terre der Vorhand; ist dagegen die Hinterhand weit, entspricht dies einem Terre-a-Terre der Hinterhand“, wenn das Pferd manchmal nach dem dritten oder vierten Seitwärtsschritt von allein die Vorhand erhebt, was ja nur mit gleichzeitiger Unterstützung beider Hinterbeine erfolgen kann.Update 05.12.19: 95°Inzwischen stellt sich heraus, dass eine Abstellung beim Seitwärts von 95° bis 100° gar kein Fehler ist: Wenn das Pferd beim Seitwärts gehen die Kruppe „überholen“ lässt, und dabei Rumpf und Hals weiterhin gerade in ca. 85° Abstellung bleiben, ist das ein Breiterstellen der Hinterfüße, also die korrekte Vorbereitung auf einen Takt im Terre-a-Terre, der durchaus begrüßenswert ist!Update 24.12.19:Inzwischen ahne ich, was La Broue im Kapitel 37 des zweiten Bandes meinen könnte, wenn er schreibt: „Der Kunstreiter lernt den wahren Wert des Schritts erst richtig zu schätzen, nachdem er all die Übungen im zweiten Band trainiert hat.“ Ich habe zwar noch lange nicht alles probiert oder gar mit Erfolg trainiert, aber schon jetzt ist es so, dass sich der Seitwärtsschritt häufig (falls das Pferd in voller Leistungsbereitschaft ist) fast wie ein Umschalter auswirkt: hat man bald nach Beginn der Reiteinheit einige Schritte im korrekten Seitwärts zu beiden Seiten ausgeführt (und dabei vielleicht einmal die Aufforderung, für einen Schlag die Vorhand zu erheben, gegeben), sei es auf einer geraden Linie oder auf einer akademischen Volte (= Volte im Seitwärts-Schritt), geht das Pferd danach wie von allein viel versammelter und kadenzierter bei allem, was ich vom ihm möchte, und es fühlt sich tatsächlich so an, als käme all diese Freiwilligkeit „aus dem Pferdeherzen“ wie La Broue es beschreibt. Hier beginnt wohl schon die Leichtigkeit, von der er so viel spricht, und die Abwesenheit des Zwanges.
Es kristallisieren sich jetzt allmählich auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten des Seitwärts bei Fiaschi und La Broue (Renaissance-Reiterei) auf der einen Seite und Gueriniere (Barockreiterei) auf der anderen heraus, wobei die von Cavendish irgendwo dazwischen liegt. Gueriniere reitet das Seitwärts mit einer geringeren Abstellung von 60-80°, er verzichtet auf die Forderung, dabei niemals drei Füße gleichzeitig am Boden zu haben (Zweitakt), auch empfiehlt er das Seitwärts zusätzlich im Trab, und er biegt dabei das Pferd. Er warnt besonders davor, dabei die Hinterhand überholen/führen zu lassen ("entabler": nach dem ital.:"intavolare"), weil das bei dieser Art des Seitwärts zu einem „Ruinieren der Sprunggelenke“ führe. Da das Seitwärts mit einer Abstellung unter 80° häufig zu einem Hinterherziehen des äußeren Hinterbeines führt, ist dessen gymnastizierende Wirkung m.E. zumindest für die Hinterhand eingeschränkt und es scheint daher gut möglich, dass diese im Barock erst durch ein Seitwärts in Trab oder Passage erreicht wurde (was ich noch nicht versucht habe, und La Broue kaum empfiehlt).
Möglicherweise hat Guerinieres Anweisung: “Ein nicht gebogenes Pferd hat in einer Reitbahn nichts zu suchen!“, falls auch er selbst sie als ein Dogma angesehen hat, ihn dazu gebracht, die Empfehlung La Broues zu verlassen, den Hals und den Rumpf des Pferdes beim Seitwärts-Schritt gerade zu halten? (Im Umkehrschluss bedeutet dieser „Biegezwang“ ja ein Verbot jeglichen Geradegehens/-stellens innerhalb einer Reitbahn!). Für den Reiter, der ständig an der Wand klebt, ist er zwar in den meisten Fällen durchaus sinnvoll, hat er sich aber schon erfolgreich von der Wand gelöst, ist es auf dem zweiten oder dritten Hufschlag im Gegenteil sehr sinnvoll, auf ein gerades Gerade hinzuarbeiten, was ja bei der einhändigen (bzw. 3.1) Führung ohnehin nicht einfach zu erreichen ist.
Cavendish liegt zwischen den beiden Arten des Seitwärts: Er spricht zwar vom zweitaktigen Schritt, bei dem nie drei Füße gleichzeitig auf dem Boden sind (was nach meiner bisherigen Erfahrung nur möglich ist mit einer Abstellung von mehr als 80°), biegt aber die Pferde dabei, statt sie wie seine Vorgänger in Hals und Rumpf gerade zu halten. Leider sind die Reiter-Abbildungen in seinem Buch falsch geraten, sodass wir nicht wissen, wie stark bzw. schwach deren Biegungen wirklich waren, aber eine Skizze ist wohl korrekt abgebildet: diese zeigt eine Abstellung von 85° auf einer Volte, also genauso stark wie bei La Broue.
Vielleicht ist es zunächst das Beste, die Empfehlungen des jeweiligen Meisters genau zu befolgen: Möchte man ein Renaissance-Seitwärts trainieren, so wie ich zur Zeit, sollte man in allen Punkten auf La Broue hören; soll es dagegen ein Barock-Seitwärts werden, auf Gueriniere.
Mein Gefühl sagt mir übrigens, dass das gelegentliche einmalige Überholen der Hinterhand als Vorbereitung für einen Terre-a-Terre-Takt dem Pferd keine Schwierigkeiten bereitet, wenn man danach gleich wieder in die normale 85°- Abstellung zurückgeht, und dies deshalb keine Sprunggelenkschäden verursacht (immer vorausgesetzt natürlich, das Pferd ist voll ausgewachsen und nicht vorgeschädigt!).
Update 15 Mai 2020
Wieder einen großen Schritt weiter: Nachdem ich seit einigen Wochen eine leichte Sitzverbesserung erreicht hatte, indem ich mir vorstellte, meine Körper-/Handhaltung habe etwas gemeinsam mit der einer Balletttänzerin, die ihre Arme vor sich kreisförmig etwas vorwärts abwärts hält, so dass sich ihre Fingerspitzen fast berühren, habe ich nun im dritten Band des „Del L‘Arte del Cavallo“, der von Luigi di Santa-Paulina 1696 verfasst wurde, die entscheidenden Hinweise auf die damalige Handhaltung gefunden: er schreibt, dass bei der Zügelfaust „die ersten Fingergelenke unterhalb der Nägel [heute „DIP-Gelenke“, oder Fingerendgelenke] so gehalten werden sollen, dass sie auf den Bauch des Reiters zeigen“ und „die zweiten Fingergelenke beider Fäuste [heute „PIP-Gelenke“, oder Fingermittelgelenke] zueinander zeigen sollen.
Dieses ist eine Klarstellung der Handhaltung, die Prizelius später abbilden wird: Stellt man sie so, kommen die Schultergelenke des Reiters automatisch etwas, aber deutlich weiter nach hinten, die Arme werden insgesamt etwas angehoben, es tritt eine ulnarseitige Spannung der Unterarme und der Handkanten bis in die kleinen Finger auf. Der Reiterbauch tritt automatisch etwas vor, und behält von selbst und mühelos diese Lage bei: es tritt obendrein automatisch ein leichtes, aber deutliches Rückwärtsneigen des Oberkörpers auf, das mit sehr wenig Energieaufwand beibehalten werden kann. Nun halten die Fußballen einen viel ruhigeren Kontakt zur Bügelplatte. Das Pferd schnaubt vermehrt und geht sehr viel entspannter und freudiger! Man sitzt tatsächlich genau so wie auf vielen der Gueriniére-Darstellungen!
Update 17.Mai 2020 :
Die Santa-Paulina Handhaltung entpuppt
sich als DER Game-Changer: meine Terre-a-Terre Übungen im Seitwärts
auf der Volte (siehe Solleysel-Bild) kommen ihrem Ziel nun sehr viel
näher.
Cavendish schreibt dazu: Geht das Pferd
am äußeren Zügel, ist es im Galopp, geht es am inneren, ist es
im Terre-a-Terre.
Er sagt auch, dass das Pferd im
Terre-a-Terre seitwärts auf der akademischen Volte vier
Spuren macht: Das innere Vorderbein macht die äußere Spur, das
äußere Vorderbein die zweite, das innere Hinterbein die dritte und
das äußere Hinterbein die vierte Spur.
Die Reiterhaltung in diesem neuen Sitz
ist übrigens dieselbe, die der stolze Römer einnimmt, wenn er seine
Toga über einem Unterarm trägt: hier erzielt er ebenfalls eine
aufrechte, würdevolle Körperhaltung, indem er die Finger-PIP-Gelenke
dieser Hand quer zur Seite zeigen lässt und dabei seinen Unterarm
etwas nach vorn anhebt. Er bekommt einen schwebenden Gang, so wie der
Reiter einen schwebenden Sitz, welcher eine ganz neue, mühelose
Anlehnung an die Steigbütteltrittplatte erzeugt.
Jetzt machen die Gueriniere Bilder noch
viel mehr Sinn: Die Darstellung des Seitwärts' als Croupe-au-mur
zeigt für die Zügelhand genau diese Handhaltung, und nun meine ich,
dass auch die PIP-Gelenke von kleinem und Ringfinger der Gertenhand quer zur Seite zeigen, wie Luigi Santa Paulina es beschreibt.

Hatte ich anfangs befürchtet, dass mein Tambourinschwenk mit dieser neuen Handhaltung vielleicht nicht mehr so wirksam sei, ist tatsächlich das Gegenteil der Fall: nun wirkt er prompt und sanft schon mit 1/5 Einwirkung! Das ist wirklich feines und leichtes Reiten deluxe!
Auch Nestier hat sich so stechen lassen, dass seine Fingermittelgelenke genau im 90°-Winkel seitwärts, direkt auf den Betrachter zeigen, und viele andere Bilder auf der Fundstücke-Seite bilden das ebenso ab.
Update 21.05.20:
Ein wenig schäme ich mich jetzt vor meinen Pferden, dass ich all die Jahre auf ihnen gesessen habe wie ein grober Klotz!
Sie schnauben freudig sehr viel mehr, und langsam finde ich heraus, dass und wie das Zulegen und Versammeln durch Tiefer- oder Höherpostionieren der Hände funktioniert: sie werden z.B. senkrecht tiefer positioniert zum Zulegen, wobei es hilft, die Hände dabei zunehmend mehr zu supinieren (die DIP-Fingergelenke sollen auf die Reiterbrust zeigen, deshalb drehen sich die Hände immer weiter, je tiefer sie gehalten werden und je mehr das Pferd freier vorwärts treten soll). Wenige Millimeter Höhenunterschied machen jeweils einige Zentimeter mehr oder weniger Schrittlänge aus. Genauso haben es ja die Alten immer beschrieben, aber mit der falschen Hand- und Körperhaltung hatte das bei mir nie funktioniert!
Die Zügellänge wird kaum verändert, d.h. ich muss sehr viel seltener rauslassen und dann wieder nachfassen, und ich habe jetzt das Gefühl eines sehr ruhigen gleichmäßigen Sitzes, aus dem heraus man sehr viele Dinge fein abstimmen kann. Selbst mein Pinky-Push erscheint mir jetzt als grobe Hilfengebung!
Jetzt wird auch klar, warum die Alten immer wieder darauf hinweisen, nicht arrogant und hochnäsig zu wirken: man sitzt schon so würdevoll und selbstbewust, dass schon ein kleines zusätzliches Anheben der Reiternnase oder ein leichtes pikiertes Mundverziehen auf den Mitmenschen abstoßend wirken kann.
Mal sehen, wass noch möglich ist! Es bleibt spannend!
Update 23.05.20:
Es ist für mich fast ein Déjàvu: So wie ab 2012 nach ihrer Wiederentdeckung und Definition die Schulparade auf einer alten Darstellung nach der anderen auftauchte, erkenne ich jetzt überall die wiederentdeckte “Santa-Paulina-Handhaltung”: sie ist ja auf den meisten Bildern aus dieser Zeit zu sehen, wurde also überall angewendet. Wir konnten sie nur deshalb nicht erkennen, weil wir bisher keinen Begriff und nicht die passende Definition dazu hatten! Sie war die Voraussetzung für das akademische Reiten bei Cavendish, Pluvinel, Gueriniere, Eisenberg, Prizelius, usw.,usw.! (Wann diese Art zu reiten endete, kann man gut an den beiden Reiterdenkmälern vor dem Braunschweiger Schloss erkennen).
Update 06. Juni 2020:
Die
Santa-Paulina-Handhaltung, die ich ab jetzt als „alte akademische
Handhaltung“ bezeichne,
bewährt sich immer mehr:
feinste Bewegungen produzieren prompte Reaktionen: der Pinky-Push,
der Pinky-Pull, die Rotation des Daumens nach außen zum Abwenden:
alles geht federleicht, muss aber ganz genau dosiert werden:
„millimetergenaues Reiten“ eben!
Hat man dies eine Zeitlang
im Sattel geübt, kann man als Fußgänger perfekt nachvollziehen,
wie es auf dem Pferderücken einwirkt: gehe ich wie ein Römer mit
Toga über dem mit 90° angewinkeltem rechten Unterarm, mache dabei
eine Faust und lasse das Mittelgelenk meines rechten Mittelfingers
wie eine Pfeilspitze nach links zeigen, straffen sich die Muskeln
meiner Brustwirbelsäule und mein Gang wird schreitend, etwas
schwebend (auf dem Pferd bedeutet das, ich sitze genau in der Mitte
zwischen Vorhand und Hinterhand, im Gleichgewicht).
Mache in nun den
Pinky-Push, d.h. kippe ich die Faust so, dass der kleine Finger
vorwärts geschoben wird, merke ich, wie ich nach vorne „falle“,
mein Bauch kommt etwas vor und mein Gleichgewicht zieht mich etwas
vorwärts: meine Schritte werden etwas länger (Das Pferd machte dann
längere Schritte und legt so zu).
Mache ich dagegen den
Pinky-Pull, rotiere ich also die Faust so, dass ich den kleinen
Finger zu mir ziehe, werden meine Schritte kürzer, weil mein
Gleichgewicht sich etwas nach hinten verlagert, und mein Bauch etwas
eingezogen wird (Die Schritte des Pferdes würden kürzer, es
versammelt sich).
Auf dem Pferd kann man
sich den Pinky-Pull auch so denken, dass man bei tiefstehender Hand
die Fingerendgelenke auf die Reiterbrust zeigen lässt.
Drehe ich die Faust so,
dass der Daumen nach rechts zeigt, merke ich eine überraschend
drastische Verlagerung des Gleichgewichtes nach links, und vice versa
beim Rotieren nach rechts.
Im Sattel kommt noch die
leichte Supination der Zügelhand dazu, (die ich mit der Gertenhand
spiegele, damit ich einen möglichst gleichmäßigen Sitz habe). Die
Supination ist nötig, weil es nicht möglich ist, die Zügelhand
wirklich genau über dem Widerrist zu halten, denn Abweichungen gehen
immer zur Zügelhandseite hin. Deshalb muss immer der gertenseitige
Zügel entlastet und der andere Zügel etwas angezogen werden.
Richtig schwierig für
mich (wohl aufgrund meiner leichten Wirbelsäulenverkrümmung) ist
es, im Linkshändersitz zu reiten: dann ist ja die Zügelhand die
rechte, und es ist für mich sehr schwer, die Fingermittelgelenke wie
Pfeilspitzen 90° nach links zeigen zu lassen: konzentriere ich mich
aber sehr darauf, dankt es mein Pferd mit ausgiebigem Schnauben!
Die Geschwindigkeit des
Pferdes wird nun auch mit einem Verstellen der Höhe der Reiterhände
übe dem Widerrist geregelt: Eine sehr tiefe Hand mit Pinky-Push
bedeutet maximales Zulegen (der Reiterbauch kommt vor) mit eher
tiefer Einstellung des Pferdekopfes: Eine sehr hohe Handhaltung mit
Pinky-Pull ergibt eine maximale Versammlung mit eher hoch
eingestelltem Pferdekopf (siehe Statuette von Heinrich IV.).
Im Moment benutze ich noch
häufig „kissing PIPs“, d.h. ich halte beide Fäuste so dicht
beieinander, dass die Mittelfinger-Mittelgelenke sich häufig
berühren und so gegenseitig feststellen.
Update 18.06.2020:
Die Santa-Paulina Handhaltung macht das Pferd so wunderbar ausbalanciert und frei auf der Vorhand, dass ich häufig gar nicht nachkomme. Sehr viel Spaß macht zur Zeit die Carriere: KORREKTUR: Ich starte sie, indem ich dem Pferd viermal hintereinander auf derselben Stelle die Wadenhilfen zu einer Levade gebe: die ersten beiden Male mit einem leichten Pinky-Pull, beim dritten Mal aber drehe ich die Fäuste in einen deutlichen Pinky-Push, sobald das Pferd die Vorderbeine vom Boden löst: es macht dann zwar die dritte Levade noch mal ganz normal, aber wenn ich nun zum vierten Mal die Hilfen mit den Waden gebe, schießt das Pferd derart nach vorne, dass ich die hintere Galerie nicht selten nach hinten biege und froh bin, dass es diese gibt, denn ohne die Galerie würde ich vielleicht hinter den Sattel rutschen: so mächtig ist der Antritt des Pferdes! Leider ist es nicht selten so, dass ich dem Pferd dabei ins Maul falle: deshalb werde ich demnächst versuchen, die Levaden und die Carriere mit durchhängenden Zügeln auszuführen.
Update im 2.Monat nach Entdeckung des Grals (nG)
Für meine Reiterei hat eine neue Zeitrechnung begonnen, für mich bemesse ich sie nun in „Monaten nG“.
Wieder muss ich sehr viel ändern, so wie zu Beginn meiner Suche nach dem alten akademischen Reitersitz im Frühjahr 2016. Beibehalten kann ich zwar die schon jahrelang genutzte Beinhaltung „etwas vor dem Pferd“, aber bis die neue Handhaltung ständig automatisch eingenommen wird, werden wohl so einige Monate vergehen.
Jede einzelne Reitsituation erfordert eine Anpassung, jede Hilfe wird nun immer wieder von neuem hinterfragt und häufig auf eine neue Weise und in anderer Kombination als zuvor angewendet.
Weil mein Sitz viel ruhiger und steter geworden ist, geht das alles (wenn ich konzentriert bin) sehr leicht und elegant: zunehmend dreht sich das Pferd unter mir.
Die Bewegungen des Pferdes sind jetzt viel besser steuerbar: ausgreifende und versammelte Gänge gehen sanft ineinander über, und nun hilft der Pinky-Push sogar, Pacos gelegentliches Stolpern im Gelände zu verhindern.
Jetzt gewinnen auch andere Dinge eine neue Wichtigkeit, weil sie möglich werden: z.B. die Anweisung der Santa-Paulinas (wie der meisten alten Meister), der Reiter solle immer durch die Ohren des Pferdes nach vorn sehen, welche ich noch häufig im Galopp missachte, weil ich manchmal noch in den Zirkel sehe (analog zur Garrochaarbeit). Allein dadurch ändert sich ja die Hilfengebung enorm.
Ausnahmen von dieser Regel sind: wenn der Reiter an hohen Gästen vorbeireitet, soll er sie ansehen; und falls er Teil einer Formation ist, muss er den Abstand zu den anderen Reitern beurteilen können. Und Cavendish schreibt, dass man im Terre-a-Terre ausnahmsweise nicht durch die Ohren des Pferdes, sondern etwas nach innen, zur Innenseite des Pferdekopfes sehen soll: dies halte die Reiterhand stet.
Übrigens schreiben die alten Meister, dass ein Terre-a-Terre nur Sinn mache in einer akademischen Volte, aber nicht seitwärts entlang einer geraden Linie. Cavendish sagt, der Reiter solle dazu etwas mehr in den äußeren Bügel treten, und so seinen Körper aussen etwas konkav halten, und seine Hände müsse er tief stellen.
Update 18.07.20
Hat man eine Zeitlang die Anweisung befolgt, immer zwischen die Ohren des Pferdes nach vorn zu sehen, erkennt man sehr schnell, wie wirr vorher die Hilfengebung gewesen war: hatte ich als Springreiter Erfolg mit der Regel, schon über dem Hindernis zum nächsten Sprung zu shene (und damit den Kopf und etwas die Schultern zu drehen), damit das Pferd bereits im richtigen Galopp landete, oder beim Garrochatraining sich zur Mitte der Garrochavolte zu drehen, ergibt sich jetzt ein unendlich feineres Reiten. Das beginnt damit, dass sich zunächst der Pferdekopf auf die Zirkellinie einstellen muss, damit der Reiter danach durch das Durch-die-Ohren-sehen seinen Oberkörper nur so minimal, kaum spürbar, dreht wie die Zirkellinie es erlaubt.
Mit der neuen Santa-Paulina-Handhaltung dazu hält und bewegt sich das Pferd viel freier, und trägt seinen Kopf nicht nur in der Einstellung der Höhe selbst, sondern auch bezgl. der Seiten: hat es ihn erst einmal zu einer Seite gestellt, bleibt er von allein so lange in dieser Stellung, bis das Pferd vom Reiter explizit zu einer Änderung aufgefordert wird; hier kann man entweder durch Anlegen/sanftes Klopfen des zukünftigen inneren Wade am/vor dem Gurt ein promptes Biegen um diesen Schenkel erreichen, oder durch Zeigen der Gerte an der künftigen Außenseite. (Im Rechtshändersitz auf der rechten Hand z.B. führt letzteres dazu, dass ich als die beste Möglichkeit tatsächlich gelegentlich das minimale Anziehen des rechten Zügels mit der rechten Hand zusätzlich zum Zeigen der Gerte einsetze, genau so wie Gueriniére und Nestier es darstellen).
Die Reihenfolge ist jetzt also umgekehrt wie vorher: Jetzt stellt und biegt sich zuerst das Pferd, und erst danach/dadurch folgt das minimale, kaum spürbare Mitgehen der Körperhaltung des Reiters infolge des Durch-die-Ohren-Sehens.
Das Abwenden hatte ich bisher so durchgeführt: mit kompletter Drehung des Zügelhanddaumens auf die Außenseite der Wendung, und konsekutivem, deutlichem Schieben mit dem äußeren, von sich weg biegendem Zügel nach innen, begleitet von einer deutlichen Rotation meines Oberkörpers mit Hineinsehen in die Volte/Zirkel; jetzt, mit der neuen Handhaltung, muss ich diese Außenrotation des Zügelhanddaumens nur noch ganz leicht andeuten, ja fast nur denken! Meine Verstärkung durch ein leichtes Anheben des inneren Sitzknochens lässt das jetzt viel ausbalanciertere Pferd sanft und leicht zur betreffenden Seite treten: die Gewichtshilfen des Reiters übernehmen jetzt eine viel größere Rolle.
Für die Mitreiter in der Reitbahn wird es allerdings schwerer, meine Absichten zu erkennen: sie müssen sich etwas umstellen, da ich nun (in ihren Augen ganz plötzlich) ohne vorher hinzusehen eine neue Richtung einschlage! Sie müssen lernen, dass ab jetzt genau in die Richtung, in die das Pferd blickt, geritten wird. (Ausnahme: ich reite im Seitwärts, denn dann wird ja der Pferdekopf nur minimal in die Bewegungsrichtung gestellt, und der Reiter blickt aus dem Zirkel heraus, ganz so wie Ridinger es darstellt, sowohl im Schritt als auch im Terre-a-Terre).
Update 01.08.20Bei der Santa-Paulina-Handhaltung ist ein wichtiges Ziel das Entfernen der Reiteroberarme vom Brustkorb. Man muss zunächst die Fingermittelgelenke wie zwei Pfeilspitzen zueinander zeigen lassen, dann darauf achten, nicht die Hände im Handgelenk zum Handfläche hin abzuknicken (= keine Flexion im Handgelenk), sondern im Gegenteil eine leichte (20°) Überstreckung im Handgelenk erzeugen: erst dann entsteht die korrekte seitliche Entfernung der Oberarme vom Brustkorb und so ein freies Schwingen des Reiteroberkörpers mit dem Resultat einer guten Aufrichtung des Reiters.
Ob die Abstellung der Oberarme ausreichend ist, überprüft man gelegentlich mit der Gertenhandhaltung des alten Fritz‘ (welche genauso bei Gueriniére gezeigt wird): eventuell bemerkt man dabei, dass man seinen Zügeloberarm doch noch etwas weiter von seinem Körper wegführen muss, um dadurch beide Schultergelenke gleich weit zurückzunehmen: nun kommt es zur besten Aufrichtung des Reiters.
Aus "Ecole de cavalerie", Guerniére, 1733;
(nebenbei bemerkt: die Länge der Unterbäume dieser Trensenkandare verhindert, dass die Zügel noch weiter angezogen werden können:
das Pferd kommt nicht hinter die Linie > so wird es sich nicht "aufrollen").
Update 07. Sept. 2020:
Freie Gedanken über William Cavendishs Kappzaumgebrauch
Alle Reiter, die sich mit dem zunehmend wiederentdeckten Wissen der alten akademischen Reitkunst befassen, lernen sehr früh, dass heutzutage alle Arten von Hilfszügeln missbräuchlich und sehr schädlich für die Pferde eingesetzt werden. Deshalb ist unser Reflex „Hilfszügel? O nein!“ völlig richtig und wertvoll. Sieht man nun, wie Cavendish eine Art Schlaufzügel propagiert, und sie sogar als den Kern seiner „Neuen Methode“ ansieht, ist unsere erste Reaktion: „So ein Barbar, der wusste es damals wohl nicht besser!“.
Die Reitmeister, die nach Cavendish kamen, dachten allerdings anders: So kenne ich mindestens sechs Kupferstiche von Ridinger, drei Stiche bei Eisenberg, und acht Stiche bei Andrade, sowie zwei korrigierte Darstellungen bei Solleysel, auf denen seine Methode zum Anlernen angewendet wird, und auch Gueriniére erwähnt sie in seinem Buch, ohne sie zu kritisieren (Gueriniére lehnt den Kappzaumgebrauch bei seinen Reitschülern allerdings grundsätzlich ab, da sie damit die kostbaren, hoch ausgebildeten Schulpferde zum Ziehen bringen und verderben). Alle diese Reiter gehörten zu den besten ihrer Zeit, alle behandelten ihre Pferde äußerst sorgsam: sollten sie sich etwa alle geirrt haben?
Tritt man einmal etwas zurück, und lässt den Gedanken zu, dass ausnahmsweise dieser Hilfszügel in manchen Situationen angebracht sein könnte, wird zunächst einmal klar, dass dieser ja nicht, wie die heutigen schädlichen am Gebiss, sondern am Kappzaum befestigt wird, also eine ganz andere Einwirkung auf das Pferd, und gar keine auf das Pferdemaul hat.
La Broue weist 60 Jahre vorher ausdrücklich darauf hin, dass der Kappzaum ausschließlich dazu da sei, dem Pferd den Willen des Reiters verständlich zu machen, und deshalb müsse jede Aktion des Kappzaums sogleich von der entsprechenden Aktion der Kandarenzügel gefolgt werden: für ihn ist das Reiten mit dem Kappzaum allein, ohne eine Kandare, schädlich und sollte deshalb nie angewendet werden. Das Anlernen der Pferde nur auf Kandare aber ist nicht möglich, ohne das Pferdemaul zumindest etwas zu belästigen und abzustumpfen.
Eine von Cavendishs Begründungen für seine neue Art den Kappzaum anzuwenden ist, dass manche Pferde bei Anwendung der alten Art die Reiterhand bezwingen können, und ihren Kopf dann nicht dahin nehmen, wohin der Reiter ihn stellen und halten möchte (was ja dazu führt, dass der Reiter Gegendruck aufbaut, und völlig aus seinem Sitz kommt: dies macht feines Reiten in Ruhe und Ausgeglichenheit unmöglich).
Weitere Begründungen Cavendishs sind die veränderten Einwirkungsrichtungen, die je nach Lektion ggf. die besseren seien. Als Grundlage für alle Varianten befestigt er immer das eine Ende der Kappzaumleine am Sattelknauf (fixes Ende), und führt es hinter der vorderen Sattelgalerie herunter: kommt diese Leine unter der Galerie hervor, bildet sie zum inneren Kappzaumring eine eher waagerechte Linie. Einzige Variante dieses Leinenendes ist, es hinter der Galerie hervorzuholen und herauszulassen, sodass diese (bis dahin innere) Leine durchhängt, um bei Bedarf die vorher durchhängende Kappzaumleine auf der anderen, neuen inneren Seite hinter der anderen Galerie einzuhängen.
Das andere, variable Leinenende hält er entweder in der Hand, oder er bindet es am Sattelgurt fest, oder am Sattelknauf, wohin es dann in direkter Linie läuft.
Hält er das variable Ende in der Hand, führt er diese Hand bei einigen Übungen auch mal zu seinem gleichseitigen Knie, und manchmal quer über den Mähnenkamm zu seiner gegenüberliegenden Hüfte oder Schulter.
Die Kraftrichtung (den Vektor), in die der innere Kappzaumring gezogen wird, findet man in der Mitte zwischen den beiden Zügelleinen.
Das variable Ende am Sattelgurt befestigt oder zum Reiterknie gezogen arbeitet die äußere Schulter.
Das variable Ende direkt am Sattelknauf befestigt oder gezogen bringt die innere Schulter nach vorn und die äußere Schulter nach hinten. Dies komprimiert die äußere Seite und verschafft den inneren Beinen Freiheit, und deshalb sei es sehr geeignet für den Terre-a-Terre, aber nicht für Courbetten, da es hierfür die Kruppe zu stark in Zwang bringe.
Ein großes Problem mit den Darstellungen in Cavendishs erstem Buch sind die unkorrekt und massiv übertrieben dargestellten Überbiegungen, und wenn man nicht weiß, dass auch Cavendish selbst diese Kupferstiche falsch fand, sie aber aus Geldmangel nicht neu anfertigen lassen konnte, könnte man auf den Gedanken kommen, sein Gebrauch des Kappzaumschlaufzügels sei die Ursache, was aber nicht der Fall ist.
Will man diesen Kappzaumschlaufzügel selbst ausprobieren, sollte man sich also hinsichtlich des Biegungsgrades lieber an den Interpretationen seiner Nachfolger orientieren.
Was die Befestigungspunkte des Kappzaumschlaufzügels betrifft, ist es aber nicht ohne Weiteres möglich, seine Anweisungen ganz exakt zu kopieren: schon 60 Jahre nach ihm war es nicht mehr üblich, an den Schulsätteln einen Sattelknauf anzubringen, und so wurde behelfsmäßig eine Öse am Vorderrand des Sattels in Höhe des Reiterknies angebracht.
Einige Erfahrung in der akademischen Reitkunst, vor allem hinsichtlich der schonenden und äußerst bedachten Behandlung der Pferde, und ein gefestigter Sitz nach der alten akademischen Reitkunst sind natürlich die Voraussetzung, überhaupt beurteilen zu können, ob dieser Kappzaumschlaufzügel wirklich hilfreich ist; eine andere ist ein ausgewachsenes Pferd, dass diese Belastung schadlos aushalten kann: Cavendish beginnt die Ausbildung erst mit sechs, gerne auch erst mit sieben oder acht Jahren! Dann allerdings brauche er für die Grundausbildung auch nur 3 Monate.
Die Variante, auch das zweite, variable Ende festzubinden, erzeugt eine eher starre Einwirkung, und ist außerdem nur möglich, wenn man einen Sattelknauf und ausreichend weit nach unten reichende vordere Galerien wie Cavendish hat: nur dann kann man ja bei Bedarf vom Sattel aus eine Kappzaumleine ein- und die andere aushängen; hat man jedoch nur eine Öse am vorderen Sattelrand, müsste man beide Kappzaumleinenenden hier festbinden und deshalb für jeden Handwechsel absteigen und auf der einen Seite lösen und auf der anderen Seite festbinden. Hätte man einen Sattelknauf, könnte man außerdem beide Enden aushängen und dann ein Ende in die Hand nehmen und etwas dosieren.
Meine ersten Tests, mit dem fixen Ende ganz oben an der Sattelgurtstrippe meines Eponas befestigt und dem variablen Ende in meiner Hand waren durchaus positiv: meine Pferde sind ja alte Hasen, ich reite seit 3 Jahren fast ausschließlich einhändig auf Kandare und habe inzwischen gelernt, wie man mit einer Kandare etwas stellt, mit dem äußeren Zügel und der Gerte außen schiebt, wie man mit dem Sitz hilft und bekam jetzt bei der Übersetzung von Cavendish obendrein wieder in Erinnerung gerufen, dass man den um sich herum biegenden Zügel zum Stellen und Biegen des Halses benutzen könnte. Trotzdem ist das Stellen mit dem Kappzaumschlaufzügel natürlich viel einfacher, und die Pferde biegen den Hals auch auf der steifen Seite anders. Man setzt mit dem Kappzaumschlaufzügel nur minimal Kraft ein und kann dabei mühelos seinen Sitz erhalten. Ungewohnt ist, dass man die doppelte Leinenlänge einholen muss, und beim Handwechsel muss man zu Anfang richtig nachdenken (ich nenne das immer scherzhaft: „die Zügel zählen“).
Jetzt vermute ich, dass Cavendish die Gerte immer in der rechten Hand hält, weil die Umstellung sonst zu groß wäre. Ich weiß jetzt auch, dass es eine große Erleichterung ist, die äußere Kappzaumleine einfach aus der Hand fallen und durchhängen zu lassen. Weil ich seit Jahren schon als Zügelhand an einem Tag meine rechte, am nächsten meine linke Hand einsetze, fällt es mir beim Handwechsel nicht ganz so schwer, die Kandarenzügel in die neue äußere Hand und das variable Leinenende in die innere Hand zu nehmen.
Aber meine größte Schwierigkeit ist es im Moment, daran zu denken, nie den Kappzaum allein zu benutzen, sondern entweder, beim ganz ungeschulten Pferd jeder Kappzaumeinwirkung sogleich eine Einwirkung mit den Kandarenzügeln folgen zu lassen (wie La Broue), oder, wie es mir bei meinen schon etwas ausgebildeten Pferden sinnvoller erscheint, zunächst immer eine Wirkung mit den Kandarenzügeln zu versuchen, und erst bei nicht/nicht ausreichendem Ansprechen des Pferdes den inneren Kappzaumschlaufzügel einwirken zu lassen (wie Cavendish): die Kandarenwirkung soll immer Hauptzügel und Ausbildungsziel bleiben.
Ein Problem ist die viel direktere, und damit schnellere Reaktion des Pferdes auf die Kappzaumleine: nach 10min hochkonzentrierten Trainings lässt meine Aufmerksamkeit deutlich nach und ich ertappe mich immer wieder dabei, zum Biegen einfach nur schnell mal den Kappzaum zu benutzen. „Wer ein Mittel parat hat, benutzt es auch!“ sagt man ja: deshalb muss man sich bei diesem Mittel bewusst eine starke Zurückhaltung auferlegen, sonst produziert man das von Gueriniére gefürchtete Ziehen des Pferdes an der Reiterhand und andere Fehler.
Ich betrachte jetzt jeden Einsatz der Kappzaumleine als Zeichen für ein Versagen meiner Kandarenzügelhilfen, und versuche, immer ganz in Ruhe zunächst die langsameren und mehr Überlegung erfordernden Kandarenhilfen zu geben, was voraussetzt, dass ich Genauigkeit vor Promptheit setzen muss: also lieber einen oder zwei, oder drei Schritte des Pferdes abwarten, ob es sich mit Kandare und Kandarenzügelhilfen allein in die, je nach Größe des Kreises gewünschte schwächere oder stärkere Biegung bringen lässt. Erst danach setze ich den Kappzaumschlaufzügel ein, ganz sanft, fast durchhängend zunächst, und nur bei ausbleibender Reaktion des Pferdes stärker anziehend. Je stärker ich ihn anziehen muss, umso größer ist der Vorwurf an mich, nicht gut genug ohne diesen arbeiten zu können!
Interessant ist der Übergang vom Schulterherein entlang einer geraden Linie zum Seitwärts auf derselben geraden Linie (z.B. als Croupe-au-mur): beginne ich das Schulterherein nach rechts mit der rechten Kappzaumleine (und der Gerte) in der rechten Hand, und schwenke dann während des Weitergehens um ins Seitwärts, muss ich, weil ich die beiden Kandarenzügel nicht in die andere Hand wechseln möchte, aber auch die neue innere (linke) Kappzaumleine nicht zusätzlich in die linke Hand nehmen will, den linken Kappzaumzügel mit der RECHTEN Hand fassen und einwirken lassen, was automatisch den um sich herum biegenden Zügel ergibt, der durchaus hilfreich ist, aber sehr vorsichtig dosiert werden muss, da beim Seitwärts eine so gering wie mögliche Halsbiegung erforderlich ist.
Es sind natürlich sehr viele weitere Testtage nötig, um ein fundierteres Urteil fällen zu können, und dazu ein mit dieser Methode unterstütztes Anlernen von ungerittenen Pferden, und auch viele Erfahrungen anderer Reiter.
Erst wenn wir mehrere von erfahrenen Reitern angelernte und ausgebildete Pferde haben, die nie auf Wassertrense oder allein auf Kappzaum geritten wurden, also gleich von Anfang an mit einer geraden mittellangen Kandare plus Kappzaumschlaufzügel auf der Innenseite nach Cavendish, werden wir etwas mehr darüber sagen können.
Update 17.09.2020
Weil ich früher gelernt hatte, dass man sich im Sattel zurücksetzen solle, um die Hinterhand zu beschweren, damit sie Belastung aufnehme und das Pferd so auf die Hüften komme, hatte ich bisher Cavendishs Empfehlung, im Sattel so weit wie möglich vorne zu sitzen, ignoriert, und ihn deshalb nicht als mein Sitzvorbild gewählt.
Jetzt aber las ich bei Solleysel, dass man für den Terre-a-Terre so weit im Sattel vorne sitzen müsse, dass der Reiterbauch den vorderen Sattelrand berührt! Und tatsächlich gelingt mir jetzt endlich ein echter Terre-a-Terre für einige Sprünge, obwohl ich meinen Bauch nicht ganz an die vordere Galerie bringen kann! Meine Erklärung: das Pferd setzt im Terre-a-Terre seine Hinterfüße derart weit nach vorne (unter den Sattelgurt), dass auch der Schwerpunkt des Pferdes mit Reiter nach vorn kommen muss.
Intermezzo 21.09.2020
Vor einigen Monaten las ich, dass im Keltischen der Name der Pferde- und Reiterschutzgöttin Epona als Ipona ausgesprochen wird. Damals kam mir gleich der Verdacht, dass Ipo von Hippo = griech.: Pferd stammen könnte, obwohl ich nirgends einen Hinweis auf eine griechische Herkunft, sondern nur auf eine römische fand.
Jetzt stieß ich auf Bellerophon, der vor seinem neuen Namen den Namen (H)Ipponoos = Pferdekundiger/Pferdeversteher trug, so wie drei andere Sagengestalten der griechischen Mythologie. Die weibliche Form ist (H)Ipponoa, was, davon bin ich überzeugt, dann zu Epona wurde.
Wer weiß, vielleicht werde ich mich nach einiger weiterer Forschung bei zunehmendem Verstehen dazu berechtigt fühlen, meine Artikel zu unterzeichnen mit:
Daniel Ahlwes Hipponoos
Update 22.09.2020
Durch die Übersetzung des Cavendish erscheint jetzt die Statue des Marc Aurel in einem neuen Licht: Es handelt sich hierbei gar nicht um ein Trabpassage, welche der Künstler aus Statikgründen nicht naturgetreu ausführen konnte, sondern hier ist ein Seitwärts im Schritt dargestellt!
Die Handhaltung entspricht der von William Cavendish angewendeten: Die Zügelhand wird über den Mähnenkamm nach außen geführt, um ein Biegung des Pferdehalses und ein Hereinführen der Kruppe zu erzeugen. Dies ist die Voraussetzung für das Seitwärts, welches häufig als Passage bezeichnet wurde.
Die Haltung des Pferdekörpers entspricht dem Seitwärts im Schritt mit einer Abstellung geringer als 80°: so kommt es zwar zu einer vollen, gleichzeitigen Diagonalisierung beim Übertreten des äußeren Vorderfußes über den inneren, mit gleichzeitigen breiten Seitwärtstreten der Hinterfüße, aber einem Nachschleppen des äußeren Hinterfußes bei dessen Übertreten in der nächsten Pase, wenn die Vorderfüße breit auseinander treten. Diese Phase ist hier dargestellt: der äußere (linke) Hinterfuß hebt gerade ab, ist aber noch in der breiten Stellung, während die Vorderfüße schon fast ihre breiteste Stellung erreicht haben. Nikolas di Santa Paulina schreibt: in der Schrittpassage folgt ein Hinterbein unmerklich später.
Ein Autor der alten Schreibkunst beschrieb als Prämisse:“In der Passage ist das Pferd immer zu der Seite gebogen, nach der es geht.“ Das bedeutet, eine Passage geradeaus auf einem Hufschlag war damals nach dieser Definition gar keine. Sie beschreibt aber nicht, wie stark seitwärts man in der Passage geht, d.h. wie stark die Abstellung ist.
Das schöne, starke Anheben des rechtes Vorderbeines ist entweder andressiert oder es handelt sich hier um ein Pferd, das spontan so außergewöhnlich geht, es ist aber für die Definition der Passage nicht erforderlich.
Wie stark seitwärts Marc Aurels Pferd hier geht, kann man nicht ablesen an seiner Blickrichtung, denn wenn damals schon die Regel galt, dass der Reiter nur eine anmutige Haltung einnehmen kann, wenn er zwischen den Ohren des Pferdes, oder etwas nach innen entlang der Innenseite des Pferdekopfes blickt,
Dies alles impliziert, dass dieser schöne Gang dazu führte, dass der Herrscher immer schräg, vielleicht sogar ganz quer zum Weg an seinem Publikum vorbeiritt . Vielleicht wechselte er dann die Seite, nach der er ging?Oder blieb er in dieser Kampfstellung für einen rechtshändigen Reiter? Dann hätte sein Paradeweg wohl eine „Schokoladenseite“ gehabt, auf der die wichtigen Leute standen, damit der Herrscher sie bemerkte und ansah (in diesem Falle die linke Seite des Paradewegs)!
Update 04.10.2020:
Levade
Carriere
Seitwärts / Passege / Passage im Schritt,"der die Aktion des Trabes hat."
Ist in der Passage die Vorhand weit, ist das ein Terre-a-Terre der Vorhand, ist die Hinterhand weit, ist das ein Terre-a-Terre der Hinterhand."(W.Cavendish)
Ein Pferd, das auf der Volte eine Passage (=85°-Seitwärts) im Schritt ausführen kann, ist bereits als "halb-fertig"(demi-dresseé) zu bezeichnen.
Diese Übung (im Schritt) wirkt auf das Pferd extrem meditativ, sie bewirkt nicht nur eine körperliche, sondern auch eine starke psychische Versammlung und nimmt fast den ganzen Fluchtdrang des Pferdes weg: das Pferd ist danach bereit, alles auszuführen was es nach seinen Kräften kann (falls der Reiter in der Lage ist, die richtigen Hilfen zu geben).
Diese Übung im Trab auszuführen ist keine Steigerung, sondern führt im Gegenteil zu einer Verschlechterung ihrer Wirkung. Die weitere Ausbildung geht deshalb auch nicht über den Trab, sondern aus dem Schritt gleich in den Terre-a-Terre oder in die Courbetten.
Definition: Der Terre-a-Terre ist eine galoppähnliche Seitwärtsbewegung des Pferdes die zweitaktig wirkt, in wirklichkeit aber 6-taktig abläuft, seitwärts im rechten Winkel (ca. 85-90°) ohne Vorwärts: er dient zum rasanten Umkehren des Pferdes in die Gegenrichtung am Ende einer geraden Linie, entweder als Demi-Volte oder pirouettenartig, wenn dabei die Hinterhand ihren Platz nicht verlässt. Zum Training auch "geradeaus" reitbar, d.h. seitwärts entlang einer Wand oder geraden Linie.
Update 15.11.2020:
Seit ich den Terre-a-Terre einleite indem ich meinen Bauch vorschiebe, bietet Picasso mir immer wieder ganz ruhig stattdessen die Pirouette an, die er nun länger ausführt, sodass jetzt häufig eine ganze Pirouette zustande kommt, und gleich darauf eine ganze auf der anderen Hand: vielleicht ist ihm die Pirouette leichter als der Terre-a-Terre, oder aber meine Hilfen sind noch nicht ganz auf den Terre-a-Terre eingespielt. Für die Pirouette, also das Wenden des Pferdes auf der Hinterhand, die auf ein und derselben Stelle bleibt, muss man etwas den äußeren Zügel einsetzen. Meist kommen so fünf bis sechs Schläge zustande, den letzten macht das Pferd zur Landung auf der Stelle, an der es gestartet war.
Diese Lektionen können die Pferde allerdings nicht häufig ausführen, ohne lustlos zu werden. Hier kollidieren zwei Anforderungen an den Reiter: der Spruch „Reiten kommt von Reiten“ ist ja immer noch gültig, aber wenn das Pferd etwas höher (wörtlich) ausgebildet ist, muss man auf der anderen Seite auch die Ratschläge der Alten berücksichtigen: Der extremste kommt von William Cavendish, der rät, ein voll ausgebildetes Pferd nur einmal in der Woche zu fordern. (Ob er damit auch meint, es überhaupt zu reiten ist nicht klar). La Broue schreibt, man solle auf keinen Fall täglich Levaden, Courbetten oder Terre-a-Terre verlangen, sondern mindestens einen oder zwei Tage Pause machen. Jeder kennt ja wohl auch das Gefühl, wenn man nach ein oder zwei Wochen Urlaub das erste Mal wieder auf dem Pferd sitzt, dass alles wunderbar leicht und wie von selbst geht.
Lange Reiteinheiten in der Halle mache ich schon seit Jahren nicht mehr, sie dauern meist nur 8-15min.
Auch die Art zuzulegen und zu versammeln hat sich jetzt, durch die Santa-Paulina-Handhaltung und den Cavendish-Sitz (soweit vorn sitzen im Sattel wie möglich) langsam der alten akademischen Weise angepasst: das Pferd lernt jetzt, immer dann eher zuzulegen, wenn die Reiterhände sehr tief stehen, und sich in dem Grade zu versammeln, wie die Hände höher genommen werden.
Immer seltener ertappe ich mich dabei, bei allen Arten von Volten, Zirkeln und Wendungen nicht durch die Ohren des Pferdes zu sehen.
Den Schlaufzügel am inneren Kappzaumring habe ich nur eine Woche lang ausprobiert, da meine Pferde ja meine Hilfengebung mit der Trensenkandare sehr gut kennen. Wenn ich irgendwann einmal noch ein Pferd anreite, werde ich ihn aber ganz sicher einsetzen: mein Plan dafür: zunächst für wenige Wochen zu beginnen mit der Art, wie die Meister vor Cavendish ihn benutzten, also zusätzlich zur geraden, mittellangen Trensenkandare beide Kappzaumzügel zu benutzen, und jeder Kappzaumeinwirkung die Kandareneinwirkung folgen zu lassen (oder sie gleichzeitig einzusetzen), um dem Pferd zu zeigen, was der Reiter möchte, ohne das Pferdemaul abzustumpfen. All dies natürlich nur zur Ergänzung der Sitzhilfen, mit denen man ja das Pferd eigentlich reitet!
Nach einigen Wochen aber, um das Pferd nicht zum Ziehen an den Zügeln zu bringen, werde ich für einige Wochen nur noch Cavendishs inneren Kappzaumzügel benutzen (und vielleicht immer bei Einführung in eine neue Lektion).
Update 02.Jan.2021
Immer wenn man sich gerade an eine neue Regel gewöhnt hat, taucht eine Ausnahme von dieser Regel auf!
Im Monat 6 nG Picassos Terre-a-Terre wird zunehmend sicherer. In den letzten beiden Wochen, in denen ich durch einige Urlaubstage wesentlich entspannter war, bietet er mir aber , anstatt eine Volte seitwärts im Terre-a-Terre mit einem kleinen Innenkreis den die Hinterfüße ziehen, eine Pirouette im Terre-a-Terre an. Anfangs habe ich diese gerne angenommen, ohne ihn zu korrigieren: Immerhin habe ich noch nirgends von einer Terre-a-Terre-Pirouette gelesen, geschweige denn ein gesehen!
Nach ein paar Tagen aber wurde klar, dass Picasso nun meine Absicht nicht mehr erkennen konnte, da meine Hilfengebung sich ja nicht geändert hatte: Geradeaus durch die Ohren sehen und minimal am Pferdekopf vorbei zur Innenseite blicken, wie es Cavendish empfiehlt.
Als ich mir daraufhin die Bilder bei Ridinger ansah, wurde mir klar: Diese Pirouette (d.h. die Hinterbeine bleiben auf derselben Stelle bei der Wendung) erfordert eine Ausnahme von der Regel: Der Reiter muss, um sich gegenüber seinem Pferd klar auszudrücken, hierzu sehr stark in die Volte sehen und dabei seinen Oberkörper deutlich nach innen drehen, damit das Pferd versteht: dies soll jetzt eine Pirouette werden.
All die Jahre hatte ich zwar immer wieder eine Wendung auf der Hinterhand mit Erheben der Vorhand trainiert, aber weil ich nicht wusste, dass man zum sehr starken Untersetzen der Hinterbeine den Reiterbauch weit nach vorn schieben muss, waren das immer Pirouetten in Courbetten gewesen, bei denen das Pferd sein Vorderbeine schön parallel und genau auf gleicher Höhe hält, und dabei sich höher, manchmal sogar sehr hoch erhob.
Die Hilfengebung bei einer Pirouette, im Terre-a-Terre oder in Courbetten wird jetzt also um diese Komponente des Bauchvorschiebens deutlich erweitert: je mehr der Reiterbauch nach vorn geschoben wird, desto mehr setzen die Hinterbeine unter den Pferdebauch nach vorn, und greift das innere Vorderbein vor (= Terre-a-Terre), je weiter der Reiterbauch zurückgenommen wird, desto höher und erhebt es sich und desto paralleler hält es seine Vorderbeine, und desto mehr winkelt es seine Vorderbeine an ( = Courbette).
Im Moment habe ich als Ziel zunächst die „passade furieuse“ /„passade francaise“ / furiose Passade im Kopf und freue mich, wenn die Demi-Volte am den Enden der Passade in dieser Terre-a-Terre-Pirouette ausgeführt wird, da diese die schnellste Art zum Umwenden in die Richtung, aus der man gekommen ist, darstellt. Außerdem ist es ja im Kampf von Vorteil, wenn das Pferd sich nur ganz wenig vom Boden abhebt, weil ein Anprall durch ein anderes Pferd viel besser abgefangen werden kann und das Pferd dabei nicht so sehr in Gefahr ist, umgestoßen zu werden wie bei einem hohen Erheben der Vorhand. Sie fühlt sich super an!!
Wenn beim Beginn der Terre-a-Terre-Pirouette das Pferd sich rückwärts bewegt muss der Reiter, bevor er dies zu korrigieren versucht, sich fragen, ob es wirklich rückwärts geht (was falsch wäre und accülieren genannt wird), oder ob er hier nicht nur das Zurücknehmen des Schwerpunktes über die Hinterfüße, die dabei auf derselben Stelle geblieben sind, bemerkt hat (welches wünschenswert ist, um zu einer Pirouette zu kommen).
Und wenn er ein Terre-a-Terre seitwärts auf der Volte auslösen will, muss er sich schon vorher fragen: möchte ich, dass das Pferd die Hinterfüße nach vorn bringt und die Vorderfüße einen unverändert großen Kreisumfang beschreiben, wie im Schritt-Seitwärts, aus dem es sich erhebt? Oder soll das Pferd seinen Schwerpunkt nach hinten verlagern, wobei dann die Hinterfüße auf demselben Umfang bleiben wie im Seitwärts-Schritt davor und deshalb die Vorderfüße einen kleineren Kreisumfang gehen müssen als im Seitwärts-Schritt?

Update 19.01.2021
In den letzten Monaten habe ich leider stressbedingt nur wenig Energie zum Übersetzen aufbringen können, aber stattdessen die bisher übersetzten Kapitel des Cavalerice francois allesamt verbessert und zu korrigiert: mein Verständnis der Lektionen, aber auch mein Französisch haben sich seit Beginn der Übersetzung vor vier Jahren doch erheblich verbessert!
Update 28.03.21:
1741 schreibt François Alexandre de Garsault im "Le Nouveau parfait marechal" über die Gertenhaltung: "In der Manege, oder während er eine Lektion ausführt, hält der Schulreiter die Gerte wie für die Lektionen erforderlich [meist aufrecht mit der Spitze nach oben; DA], während einer Promenade [Spazierritt] oder bei anderen Gelegenheiten lässt man sie dagegen locker längs seines Körpers abwärts hängen".
Beim Ausritt soll man also die Gerte mit der Spitze abwärts halten, es sei denn, man möchte unterwegs eine Schul-Lektion ausführen oder die langen Strecken zum Training seiner Körper- und Handhaltung nach Santa-Paulina ausnutzen.
Sieht man sich die Stiche der natürlichen Gänge im Gelände bei Gueriniére an, bemerkt man allerdings, wie verschieden dies ausgeführt werden kann: möchte man verhindern, dass das gertenseitige Schultergelenk sich einrollt und nach vorn kommt und dadurch den alt-akademischen Sitz verfälscht, muss man die Gertenhand (zumindest intermittierend) so eindrehen wie in der Trab-Darstellung, damit man sich diese falsche Körperhaltung nicht angewöhnt.
Aus "Ecole de cavalerie", Guerniére, 1733;
Weil hierdurch das gertenseitige Schultergelenk deutlich nach hinten geführt wird (was der Reiter dann auch, um symmetrischer zu sitzen, auch auf der Zügelhandseite angleicht), wird nun dem Brustbein des Reiters ermöglicht, weiter nach vorn zu kommen. Dies erleichtert die Vorhand des Pferdes, welche sich jetzt freier bewegen kann. Das leichte Vorschieben des Brustbeines wiederum erleichter es dem Reiterbauch, nach vorn zu kommen und dies erleichtert es dem Pferd, seine Hinterbeine etwas mehr nach vorn unter zu schieben, was zu einem elastischeren Gangbild führt. Erhöht der Reiter nun noch das Ausgreifen der Vorderbeine mit dem Pinky-Push der Zügelhand, geht das Pferd ungehemmt, frei und locker mit ausgreifendem Schritt oder Trab, bzw. einem freieren Anheben seiner Vorhand im Galopp.
Auch bei dieser Körperhaltung lohnt es sich, darauf zu achten, dass die Fingermittelgelenke (PIPs) im rechten Winkel vom Pferd weg zeigen. Noch mehr als im Gelände trainiert dies einen guten alt-akademischen Sitz in der Manege, weil der Reiter damit seinen Oberkörper ruhiger hält.
Update 17.April 2021:
Benutzt man der Reiter die Hüftstütze nach Garsault, Gueriniere und dem alten Fritz, und hält die Zügelhand auf die alt-akademische Weise (also etwas supiniert, PIP-Gelenke im rechten Winkel vom Pferd weg zeigend) wird die Freiheit des Reiteroberkörpers ganz plötzlich erzielt, sobald man eine weitere Bedingung Santa-Paulinas erfüllt: das leichte Nachvornführen des Zügelsarmes, sodass Handrücken und Unterarm der Zügelhand eine durchgehende, gerade Linie bilden, im Handgelenk also keinerlei Dorsalextension vorhanden ist: plötzlich geht das Pferd viel freier und beginnt zu schnauben.
Diese Haltung dauerhaft in allen Gangarten und Lektionen auch in der Manege beizubehalten ist nicht einfach, aber der Effekt so wunderbar, dass keine Frage besteht, ob man ihn anwenden soll oder nicht!
Update 02.Mai 2021: Gute Seite, schlechte Seite?
Bisher haben wir die Seite des Pferdes, welche die besser biegbare ist, als seine gute Seite“ bezeichnet.
Durch das Reiten im Terre-a-Terre und durch die Terre-a-Terre-Pirouette wird aber zunehmend klar, dass es damals anders war. Ich bin inzwischen davon überzeugt, dass von den ersten Jahren der Reiterei an, also seit mehreren tausend Jahren, die Menschen diejenigen Pferde ausgesucht und in der Zucht bevorzugt haben, die der weit überwiegenden menschlichen Rechtshändigkeit entgegenkam: denn wenn ich ein Werkzeug, einen Speer oder ein Schwert in der (rechten) Hand trage, ist es mir sehr recht, wenn das Pferd seinen Hals nicht zu dieser Seite überbiegt, sonder es ist mir viel lieber, wenn es dies von Natur eher zur gegenüberliegenden Seite tut.
Diese steife, nun als „die Gute“ bezeichnete Seite ist auch vorteilhaft in der Passade: zunächst im Galopp weg vom Gegner, um dann möglichst mit einer blitzschnellen Umkehrung des Pferdes in die Gegenrichtung mithilfe einer tiefen Terre-a-Terre-Pirouette die Kruppe des Gegners zu erreichen. Diese ist als „Kampfmanege“, wie La Broue sie nennt, sehr gut geeignet, weil das Pferd dicht über dem Boden bleibt und so im Falle eines Zusammenstoßes mit einem anderen Pferd nicht so stark aus dem Gleichgewicht kommt, da es sehr viel eher wieder auf dem stabilen Boden ankommt als aus einer Courbetten-Pirouette, und dazu eine viel schnellere Umkehrung schafft als in einer Demi-Volte im Gallop in drei Takten.
Inzwischen glaube ich auch, dass die Reiterei der Römer diese Terre-a-Terre-Pirouetten beherrscht haben müssen, denn, wie Bent einmal in einem Vortrag berichtete, sind deren Reiter in einer breiten Reihe auf den Gegner zu geritten, haben vor ihnen durchpariert und ihre Speere geworfen, und mussten dann sogleich, geschwind und auf einem kleinen Platz, wenden, um Raum für die Reiter hinter ihnen zu schaffen. Dies geht nur mit einer Terre-a-Terre-Pirouette. Hier wäre interessant herauszufinden, ob sie zur linken Seite wendeten, weil sie rechts ihren Speer warfen, was eine schwerere Wendung ist, da meist die linke Seite des Pferdes biegsamer ist und ein zu sehr gebogener Hals die Wendung im Terre-a-Terre stört, oder nach rechts, trotzdem sie den Speer mit dem rechten Arm schleuderten, weil zum Erlernen und Ausführen des korrekten Seitwärts und Terre-a-Terres es ja viel einfacher ist, das Pferd zu seiner steifen Seite zu bewegen, als zu seiner zu leicht überbiegenden Seite.
Deshalb ist für mich inzwischen die schlecht biegsame häufig „die Gute Seite“.
Update 14.05.2021: Pirouette
Seit Picasso mir gern und häufig seine Pirouetten schenkt, wird mir klar, dass es in der alt-akademischen Reitweise keine Galopp-Pirouetten gab: Die Pirouette ist eine Wendung auf der Hinterhand, bei der diese ihre Stelle nicht verlässt: Ridinger hat z.B. einen Stich mit „Herumwerfen auf der Hinterhand“ betitelt, und genauso fühlt sich Picasso‘s Terre-a-Terre-Pirouette an! Da man aber nicht auf der Stelle galoppieren kann, gab es damals die Bezeichnung „Galopp-Pirouette“ nicht.
Update 22.05.21:
Trainiert man den alt-akademischen Sitz mit dem Hüftstütz (s. 17.04.21) kann man sich die Haltung der Zügelhand verdeutlichen, indem man sich vorstellt, man lege beim Tanzen diese Hand auf den Rücken des Partners: so hält man sie länger in der richtigen Position. Dies gilt auch beim Halten beider Hände nach vorn.
Update 24.05.21
Obwohl ich schon vor Monaten die entsprechende Stelle übersetzt hatte, wurde mir erst beim heutigen Ausritt so richtig klar, dass es wirklich so ist, wie Cavendish es beschreibt: Ich konnte für eine lange Strecke den Schatten meines Pferdes neben mir beobachten, und irgendwann fiel mir auf: wenn ich die Kandarenzügel annahm mit tiefgestellter Hand, nahm Picasso seine Nase vor und tiefer, nahm ich aber an mit höhergestellter Hand, kam die Nase herunter und das Genick höher. Cavendish erklärt, das liege daran, dass bei tiefgestellter Zügelhand nur das Mundstück, aber kaum die Kette einwirkt, bei hochgestellter Hand dagegen mehr die Kinnkette als das Mundstück. Deshalb kann das Pferd zulegen bei Einwirkung der tiefgestellten Hand im Vorwärts-Abwärts (wie bei einer Wassertrense) , und versammelt sich beim Annehmen mit höher gestellter Zügelhand.
Update 13.06.21:
Das oben Gesagte führt dazu, dass man bei der Aussage "Das Pferd nimmt Anlehnung an das Gebiss/ das Mundstück" verschiedene Arten denken muss: man kann man bei hochgestellter Hand auch sagen: das Pferd nimmt Anlehnung an die Kinnkette, da jetzt das Mundstück selbst weniger einwirkt als die Kinnkette: bei ruhiger Handhaltung, ohne diese rückwärts zu führen, zäumt sich das Pferd selbst bei. Wenn ich beim Ausritt durch meterhohes Gras verhindern möchte, dass sich das Pferd daran bedient und womöglich gar dazu stehen bleibt, muss ich nicht andauernd die Hand hoch und rückwärts ziehen: einfach in der richtigen Höhe mit der geeigneten Zügellänge die Hand ruhig an ein- und derselben Stelle stehen zu lassen ist ausreichend.
Update 03.07.21:
Die schwerste Sitzübung für mich zur Zeit ist, die Gerte abwärts in der linken Hand zu tragen, in der Hüftstützhaltung, weil es mir hierbei schwerer fällt, die Zügelhand dauerhaft richtig zu halten.
Picasso neigt dann dazu, sich zur rechten Seite zu biegen (seine biegsame Seite) und im Kruppe-nach-rechts zu gehen.
Der Tambourinschwenk (vermehrtes Beugen in der Zügelhandgelenk, hier nach links) ist jetzt etwas schwerer anzuwenden als in meinen anfäglichen Sitzversuchen mit gerade aufgestellten Fäusten.
Erstaunlicherweise aber bekomme ich nun eine noch deutlichere und promptere Gewichtsverlagerung auf mein linkes Sitzbein (und damit eine Biegung des Pferdes zu seiner linken Seite), wenn ich in der neuen Santa-Paulina-Handhaltung das Zügelhandgelenk strecke, indem ich den Unterarm und Ellenbogen nach vorn bringe, ohne dass die Zügelfaust selbst die Stelle verlässt! Eine sehr weiche und effektive Hilfe!
29.07.2021: Die erste Kapriole!
Auf Paco ist heute zum ersten Mal eine richtige Kapriole entstanden! Die Bedingungen waren wohl außerordentlich günstig: er war 4 Tage nicht geritten worden, ich hatte mehrerer Nächte Schlaflosigkeit unter anderem aufgrund extremer beruflicher Belastung hinter mir, und wie so häufig, wenn der Reiter erwartet, heute nichts besonders gut produzieren zu können, ermöglicht gerade diese entspannte Nichterwartung eben genau das. Die Temperatur war zudem in der Nacht um 14° gefallen, es war morgens, und eine etwas rossige Stute war mit in die Halle gekommen, und danach noch ein Wallach: ideale Bedingungen für animierte Bewegungen eines sonst eher ruhigen Hengstes.
Nachdem ich einige müde Versuche für ein paar Courbetten unternommen hatte, und dann zwei Versuche eine Kapriole mit einem seitlichen Flankentouchée zu erzeugen, machte ich noch einen letzten mit einem Touchée mit der Gertenspitze auf die Kruppe von oben über meine rechte Schulter: und siehe da, eine wunderbar zu sitzende Kapriole entstand! Ich war sehr überrascht, aber leider wieder mal so begeistert, dass ich, anstatt abzusteigen und zu loben, noch mehrfach versuchte, denselben Bewegungsablauf in meinem Körper zu wiederholen, was für die Ausbildung des Pferdes pädagogisch ja bekanntlich kontraindiziert ist. Trotz dieses Wermutstropfen freue ich mich natürlich unbändig, ist diese Lektion doch die Krone der akademischen Reitkunst! Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis ich sie häufiger und zuverlässiger auslösen kann! Ich vermute nämlich schon sehr lange dass die Kapriole “seine“ Air ist. Ob er allerdings in seinem Alter von 19 Jahren jemals die große Kraft aufbringen wird, eine Demi-Volte in drei Kapriolen am Ende der Passade auszuführen, bleibt abzuwarten…
Update 01.08.2021:
Nachdem ich die Ausführungen von Cavendish und Solleysel zu den Courbetten rückwärts gelesen hatte, hab ich irgendwann begonnen, auf jene Vorschrift zu pfeifen, welche besagt, man müsse dabei immer die Hände weit nach vorn nehmen, und das Pferd müsse unbedingt erst Courbetten vorwärts erlernen: Picasso hat ja immer schon die Tendenz gehabt, rückwärts zu gehen/zu landen. Sobald ich das Rückwärts in den Courbetteversuchen zuließ, ging es wunderbar: zwei, drei mal hintereinander gelang die Rückwärtscourbette auf Anhieb wunderbar. Seitdem ich sie zulasse, kann Picasso viel besser unterscheiden, ob ich vor- oder rückwärts meine. Heute hat er mir vier Courbetten seitwärts geschenkt (auf den Ausgang zu, er wollte auf die Weide), und zum ersten Mal habe ich dabei den Unterschied zum Terre-a-Terre gespürt: sie fühlen sich viel unbeschwerter und leichter zu sitzen an.
Update 21.08.2021: Achtung, diese Lektion darf nicht direkt an der Wand auf dem ersten oder zweiten Hufschlag ausgeführt werden. siehe Update 29.03.22
Gestern hatte ich mal wieder in Cavendishs erstem Buch gestöbert und eine sehr interessante Stelle gefunden, die ich heute nachgeritten habe:
Mit Picasso, der den Terre-a-Terre leichtfüßig und dicht am Boden ausführen kann, lief es gleich von Anfang an gut: sechs Sprünge parallel zur der Wand im „petit gallop“ als Passade, dann sogleich nach dem Durchparieren 2-3 Falkaden, dann Auslösen der Terre-a-Terre-Pirouette durch Herüberführen der Zügelhand auf die Außenseite des Pferdes, und in dem Moment des Ankommens wieder auf der Linie Umstellen des Pferdes auf die andere Hand durch Herüberführen der Zügelhand auf die neue äußere Halsseite des Pferdes, wieder 6 Sprünge im versammelten Galopp parallel zur Wand > Durchparieren > 2 Falkaden > Terre-a-Terre-Pirouette > Umstellen und wieder angaloppieren auf der anderen Hand.
(Frz: William Cavendish, „La methode
nouvelle & invention extraordinaire de dresser le chevaux...“, S.90,
libre II, chapitre XXVI; Antwerpen, 1658 ,
engl. Übersetzung von
John Brindley: William Cavendish, „A General System of
Horsemanship“,p.60, Book II, Chapter XXVI; London, 1748
(Faksimile-Reproduktion in Allens Classic Series 3, GB, 2000) )
Bei Paco dagegen, der sich sehr schwer tut mit dem Erlernen des Terre-a-Terres, funktionierte das Herüberführen der Zügelhand nach außen über den Mähnenkamm hinweg nicht als Auslöser für eine Terre-a-Terre-Pirouette, hier musste ich mich auf eine Pirouette in Courbetten, bzw. in der Mezair einlassen: das bedeutet, ich musste ihn nach den zwei Falkaden durch Anlegen des äußeren Zügels in die Pirouette führen, und auch meinen Bauch nicht so weit nach vorne bringen wie es für den Terre-a-Terre erforderlich ist. Für die Courbeten-Pirouette muss der Reiter geradeaus durch die Ohren seines Pferdes sehen, in der Terre-a-Terre-Pirouette hingegen ganz stark nach innen blicken (nicht nur so wenig wie im Terre-a-Terre entlang einer geraden Linie oder auf einer Volte).
An dieser Stelle findet sich ein für mich sehr wichtiger Hinweis: Da ich seit Jahren selbst tüftele, wie aus einer Levade eine Wendung auf der Hinterhand werden kann, habe ich zunächst Wendungen in der Mezair oder Courbette produziert, und erst als ich den Terre-a-Terre verstanden hatte, die Terre-a-Terre-Pirouette. Weil ich leider häufig wenig planvoll vorgehe, und meist abwarte was sich während einer Reiteinheit alles so ergibt, hatte ich seitdem oft das Gefühl: hier ist irgendetwas nicht richtig! Cavendishs Hinweis klärt jetzt einiges auf: Er schreibt, dass man eine Terre-a-Terre-Pirouette nur zu der Seite des Galopps machen darf. Da man die Hand, auf der man die Passade gallopieren will meist schon beim Beginn der Passade festlegt, ist damit also auch schon festgelegt, zu welcher Seite man die Terre-a-Terre-Pirouette macht.
Bei der Pirouette in der Mezair oder Courbette dagegen kann man sich noch bis zum Ende der Passade überlegen, zu welcher Seite man sie ausführen möchte, da diese mit einer Levade beginnen, in der Hinter- und Vorderbeine des Pferdes parallel nebeinander gehalten werden.
Reitet man also z.B. eine Passade im Gelände mit der Absicht, eine Terre-a-Terre-Piroutte am deren Ende auszuführen, entdeckt dann aber, dass der Boden an der Wendestelle dafür nicht geeignet ist, dass man schnell umschalten muss auf eine Mezair/Courbetten-Pirouette zu der anderen Seite als der Hand auf der man galoppiert!
petit gallop = sehr versammelter, kurzer Galopp, meist als viertaktiger Schulgalopp
Falkade (vom ital. "falce" = Sichel)= schnelles, kurzes, minimales Erheben der Vorhand, wobei die Vorderbeine sichelförmig nach vorn gehalten werden, weniger hoch als in der Mezair (welcher wiederum nur halb so hoch wie Courbetten ist).
Terre-a-Terre-Pirouette: diese Bezeichnung habe ich selbst erfunden. In der o.g. Textstelle bezeichnet Cavendish sie einfach nur als "Terre-a-Terre". Früher wurde "Pirouette" meist nur für das Wenden des Pferdes auf dem inneren Hinterbein, das auf derselben Stelle bleibt, verwendet, gelegentlich auch für das Wenden in Courbetten, wobei beide Hinterbeine parallel nebeneinander auf derselben Stelle umgesetzt werden. Hält das Pferd die Hinterbeine dagegen eher breit auseinandergesetzt, und werden sie nicht parallel, sondern auf "vier Spuren" bewegt, spricht man von der "Wendung in der Länge des Pferdes im Terre-a-Terre".
Die Mezair = halbe Air oder halbe Courbette (ital. "la mezza aria", frz. "le mezair" oder auch "la Demi-Courbette")
Update 02.10.21
Die beste Darstellung des Kunstreitersitzes gelang Prizelius: hier erkennt man am besten, dass die Hände so gehalten werden sollen, als lege man dem Tanzpartner seine Hände in den Rücken, ohne ihn anderweitig zu berühren. (Dieser Vergleich berücksichtigt nicht die Entfernung der Reiterhände vom Bauch, welche ja meist nur 5-25cm beträgt).
Wegen der unüblichen Zäumung auf Trense plus Kappzaum muss der Reiter hier seine Hände viel höher und weiter zurück nehmen als bei der üblichen Zäumung auf Kandare
Das minimale Nach-vorn-Führen eines Ellenbogens führt dann zu einem sehr präzisen Schwenken der Kruppe zu Gegenseite: wenn ich eine einfache Volte auf einem Hufschlag machen möchte, schiebe ich zunächst kurz meinen äußeren Ellenbogen nach vorn, damit das Pferd sich etwas auf die Kruppe setzt und diese nicht ausfällt. Sobald es angefangen hat nach innen abzuwenden, nehme ich dagegen meinen inneren Ellenbogen vor, damit es die Kruppe nicht nach innen nimmt: so kann es auf einem Hufschlag gehen.
Soll es aber auf zwei Hufschlägen mit der Kruppe einwärts gehen, hält man seinen äußeren Ellenbogen länger nach vorn und korrigiert damit den Grad der Abstellung.

In dieser Darstellung des Seitwärts' von Prizelius ist zwar die Halsbiegung/Kopfstellung zu stark, man sieht aber sehr schön, wie weit die Oberarme vom Oberkörper des Reiters entfernt sein sollen, um das Durchschwingen des Reiteroberkörpers zwischen den statischen Oberarmen zu ermöglichen: dies kann man am allerbesten im Schritt geradeaus ausprobieren. Zu sehen ist hier auch, dass der äußere (hier der linke) Ellenbogen etwas weiter vorne ist, um die Kruppe innen zu halten.
Update 22.10.21:
Endlich habe ich eine Erklärung für den Name Falkade gefunden, damit kann ich diese Lektion nun sicher erkennen: die Falkade (vom ital.
"falce" = Sichel) ist ein schnelles, kurzes, minimales Erheben der Vorhand,
wobei die Vorderbeine sichelförmig nach vorn gehalten werden, weniger
hoch als in der Mezair (welcher wiederum nur halb so hoch wie Courbetten
ist).

Die Haltung in der Falkade ist verwandt
mit der im Terre-a-Terre: auch hier werden die Vorderbeine nach vorn
genommen, um aus geringer Höhe sicher wieder auf dem Boden Fuß
fassen zu können, und auch mit der Carriere.
Cavendish empfiehlt eine Passade, an
deren Enden sich das Pferd dreimal in die Falkade erhebt, um dann aus
dieser die Terre-a-Terre-Wendung (Demi-Volte) auszuführen, um dann
die Passade zurück zu eilen und dann wieder dasselbe auf der anderen
Hand zu tun.

Darstellungen aus der Zeit, in der die
Fürsten wirklich noch an der Spitze ihrer Truppe in selbst in den
Kampf zogen, zeigen eher Falkade und Terre-a-Terre, die
Dargestellten beweisen damit ihre Fähigkeiten zur Verteidigung
ihrer Untertanen und ihres Herrschaftsbereichs; später jedoch in der
Zeit der Reitkunst am Fürstenhof verschwand die Betonung auf
Wehrhaftigkeit, es wurde nur noch Kunst um der Kunst willen betrieben
(„l‘art pour l‘art“) und bevorzugt wurden Mezair,
Demi-Courbetten und Courbetten, bei denen das Pferd grazil seine
Vorderbeine unter sich anwinkelt.
Hier eine mittlere Stellung zwischen
Falkade und Demi-Courbette:
16.01.2022: Nichts ist gewiss
Das 9. Kapitel im 4. Band im Solleysel/Cavendish bringt einige Erschütterungen meiner hart erarbeiteten Überzeugungen mit sich: Meinte ich bisher, dass die Handhaltung des Kunstreiters nach Santa Paulina und Prizelius immer die richtige sei, ist sie nach Solleysel falsch bei Zäumung auf Wassertrense: hier müsse man, wegen der zumindest zu Anfang sehr starken Kraftaufwendung beim Anziehen der beiden Zügel die Handflächen nach unten gedreht halten (pronieren).
Cavendish schreibt im Originalkapitel auf englisch, dass für den Kunstreiter einzig die Zäumung auf blanke Kandare die richtige sei, u.a. da nur sie zum Waffen- und Werkzeuggebrauch mit der rechten Hand befähige, und so sei die Zäumung auf Trense eine Dummheit.
Solleysel schreibt in seiner verbesserten (?) Übersetzung dagegen, dass für die Pferde, welche an der Reiterhand ziehen oder die den Kopf tief tragen, die Wassertrense zunächst eine sehr gute Alternative sei...
Beide gehen übrigens davon aus, dass die Wassertrense die Laden gar nicht berühre (was die heutige Forschung allerdings widerlegt hat): Für Solleysel war das ein Plus, da die Laden unbeschädigt blieben, hingegen für Cavendish ein dickes Minus, da das Pferd so überhaupt nicht auf den Kontakt des Kandarenmundstückes mit den Laden vorbereitet werde und somit unausgebildet bleibe.
Cavendish benutzt hier das Wort „trench“ für Trense. So scheint es klar, dass der Begriff von „to drench“ stammt, engl. für: „tränken“. Mit einer Trense wurde ja früher die Pferde zum Tränken eine Wasserstelle geführt. Das deutsche Wort „Wassertrense“ ist also eigentlich eine Doppelung.
Diese Erkenntnis hat Auswirkungen auf meine Namensgebung der alten Kandare, denn „Trensenkandare“ bedeutet dann ja genau genommen Kandare zum Tränken: ein Widerspruch in sich!
Beim Nachsehen, ob wenigstens meine englische Wortwahl „snaffle-curb“ unproblematisch sei, ergab sich leider laut englischer Wikipedia diese Bedeutung von snaffle: „ein Gebiss ohne Hebel, sei es gebrochen oder durchgehend“.
Will man trotzdem bei meinen bisherigen eingängigen Bezeichnungen bleiben, könnte man sich damit trösten, dass ja sogar die ursprüngliche Bezeichnung selbst nicht eindeutig war: „simple cannon“ (einfaches Rohr) wurde ja sowohl für ungebrochene als auch für gebrochene Mundstücke benutzt… Ansonsten wäre ich natürlich dankbar für Vorschläge eines korrekten und eindeutigen Namens!
Update 29.03.22:
Ich brauchte zehn Wochen, bis ich Picassos Beschwerden verstanden habe!
Vorgestern Nacht erst dämmerte mir, was er meinte: man darf niemals eine Terre-a-Terre-Pirouette auf dem ersten Hufschlag auslösen!
Vor 8 Wochen machte mich meine Hufpflegerin darauf aufmerksam, dass er beim Hufe geben sehr steif sei. Um diesen Zeitpunkt habe ich bemerkt, dass er beim Reiten fast immer seinen Rücken oder seine Kruppe angehoben hielt. Seit 7 Wochen verließ er gleich die Box und ging auf seinen kleinen Boxen-Paddock, wenn ich zum Putzen kam (dies war mir zunächst ganz recht, denn ich putze ihn immer dort, damit seine Haare nicht im Stroh verteilt werden, was ja bekanntlich zu Koliken führen kann), als Protest sah ich das zunächst nicht an, obwohl Bent schon vor Jahren genau das als Protest beschrieben hatte.
Vor 6 Wochen dann begann sich Picasso zunehmend durch Rückwärtsgehen zu wehren, wenn ich aufsitzen wollte. Während des Reitens machte er dann aber ohne Anzeichen von Unmut alles, was ich von ihm verlangte: seine 1km lange Galoppstrecke im Gelände, Mezair und Courbetten, sein Terre-a-Terre und seine Terre-a-Terre-Pirouetten innerhalb der Reitbahn. Allerdings fiel mir irgendwann beim Führen auf, dass er seinen rechten Hinterhuf auch beim Geradeaus gehen unter seine Körpermitte herein schwenkte und dabei den Huf um 20° nach innen rotiert absetzte.
Nachdem ich ihn dann 8 Tage nur minimal an der Hand gearbeitet hatte, kam der Tierarzt und röntgte Sprung- und Kniegelenk: ohne pathologischen Befund trotz seiner 14 Jahre. Er entdeckte ein leichte Lahmheit und riet, ihn nochmal 3 Wochen sehr zu schonen.
Zunächst ging ich davon aus, dass er sich vielleicht auf dem Außenpaddock versprungen hatte; der Sattel hatte auch wieder einmal einen Knick in de Mitte der Sitzfläche und musste längst wieder mal zum Auffrischen zum Sattler, vielleicht hatte es aber auch damit zu tun, dass ich vor vier Monaten wieder mal darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Picasso mich fast immer nach rechts setzt. Seitdem kann ich mich erstaunlicherweise dauernd in der Sattelmitte halten, was ich auf meinen endlich erreichten richtigen Kunstreitersitz zurückführe: hatte ihm das vielleicht nicht gut getan?
Erst gestern Nacht wurde mir klar, dass ich ihn falsch geritten hatte: es ist sehr, sehr schwer, die Hilfen zu erlernen und präzise zu geben,wenn man nebenbei auch noch Schulparade, Levade, Mezair, Courbette, Falkade und Carriere ausführen will, da sich die Hilfen sehr ähnlich sind!
Wenn ich Picasso in der Bahn das Signal zur Terre-a-Terre-Pirouette gebe, macht er meist eine ¾ bis ganze Drehung auf der Hinterhand in 3-4 Schlägen. Weil ich aber aber eine Passade trainieren wollte, bei der man nur eine Demi-Terre-a-Terre- Volte ausführt und nach dieser 180°-Wendung wieder in Gegenrichtung ansprengt, hielt ich es für sinnvoll, dies entlang einer Wand zu üben, weil er dann nicht überschießend wenden kann. Dies aber war ein schwerer Denkfehler!
Die Sprachwahl hat einen erheblichen Einfluss auf die Übungen: Wenn sich das Pferd versammeln soll, muss es Vorder- und Hinterbeine einander annähern: Man kann dafür sagen:“ Ich halte die Vorhand zurück“ oder aber: „ich treibe die Hinterbeine nach vorn“ oder man macht von beidem etwas.
Ebenso beim Reiten auf der Vorhand (also in der natürlichen Gewichtsverteilung 60% auf den Schultern) auf dem Zirkel mit Einwärtsbiegung: heute spricht man vom Schulterherein: dabei beschreiben die Vorderbeine einen kleineren Kreis als zuvor. Cavendish aber führt dazu die Kruppe heraus: dann bleibt der Kreis der Vorderbeine gleich groß und der Kreis der Hinterbeine wird größer. Man kann aber auch den Mittelweg nehmen: dann bleibt der Kreis unter dem Mittelpunkt des Pferdes/unter dem Reiter gleich groß und der Kreis der Vorderbeine wird etwas kleiner und der der Hinterbeine etwas größer.
Für das Reiten auf der Hinterhand/den Hüften des Pferdes benutzt man heute den Begriff „Kruppe herein“: dabei bleiben die Vorderfüße auf dem ursprünglichen Kreis und die Hinterfüße beschreiben einen kleineren als zuvor. Cavendish aber erreicht dies durch das Herausführen der Schulter, bei ihm bleiben die Hinterfüße auf dem ursprünglichen und die Vorderfüße beschreiben einen größeren Kreis als zuvor. Und auch hier ist als 3. Variante ein Schwenken um den Mittelpunkt möglich.
Bei der Terre-a-Terre-Volte beschreiben die Hinterbeine eine kleinen und die Vorderbeine einen größeren Kreis, das Pferd geht fast 90° seitwärts. Für den Terre-a-Terre muss sich der Mittelpunkt des Pferdekörpers über den Hinterhufen befinden, die Hinterhufe also unter dem Sattelgurt auffußen.
Auch dies kann auf dreierlei Weise erreicht werden: entweder 1. treten die Hinterfüße vor und beschreiben einen größeren Kreis als zuvor, während die Vorderbeine auf ihrem ursprünglichen Kreisbleiben (dies erreicht man durch Vorwärts treiben während der Einleitung der Terre-a-Terre-Volte; oder 2. die Hinterbeine bleiben auf derselben Linie, dann müssen die Vorderfüße weit zurückkommen und einen kleineren Kreis beschreiben als zuvor, dies erreicht man durch Zurücknehmen der Vorhand (NICHT Rückwärtsrichten des ganzen Pferdes!). Die 3. Möglichkeit ist eine Verkleinerung des Kreises der Vorderfüße zusammen mit eine kleinen Vergrößerung des Kreises der Hinterfüße.
In 2. fühlt der Reiter, dass das Pferd sein Gesäß weit nach hinten schiebt, dadurch könnte er den falschen Eindruck bekommen, dass es rückwärts tritt (was fehlerhaft und schädlich wäre).
Eine Terre-a-Terre-Pirouette aber kann nur auf die 2. Weise ausgeführt werden: das Wesen einer Pirouette ist ja eine Wendung auf der Hinterhand, die ihre Stelle nicht verlässt. Hier führt also das Gesäß des Pferdes quasi einen negativen Kreis aus, oder anders ausgedrückt: es entstehen um den Mittelpunkt mit den Hinterbeinen zwei Hauptkreise: einer der Vorhand und ein „Anti-Kreis“ des Pferdegesäßes über die Mitte hinaus!
Geht man nun an die Wand und versucht, das Pferd eine Terre-a-Terre-Pirouette auf dem ersten Hufschlag ausführen zu lassen, würde das Pferdegesäß in die Wand prallen, was das Pferd natürlich verhindern muss; so kommt es dazu, dass hier keine oder nur eine völlig unsaubere Blitzwendung in der Terre-a-Terre-Pirouette möglich ist! Weil ich das nicht erkannte und mehrere Monate 2x/Woche diese falsche Lektion anwandte, habe ich wahrscheinlich dadurch die Adduktorenzerrung und dazu eine Sehnenreizung am Sprunggelenk ausgelöst.
Mein Fehler war, all diese Wendungen in eine Klasse namens Hinterhandwendung einzustufen. Weil ja „das Sein das Bewusstsein bestimmt“ und ich seit Jahren das Seitwärts benutze, war mein inneres Bild eine Wendung AUF der Hinterhand, d.h. in Versammlung, mit einer Gewichtsverschiebung von 55-60% auf die Hinterbeine. (Das Pferd tendiert im Seitwärtsgehen auf einem kleinen Kreis dazu, die Hinterhand eher auf derselben Stelle zu belassen, weil das leichter ist: es führt dann eine Schrittpirouette aus). Eine Hinterhandwendung beim jungen Pferd ist dagegen ein einfaches Herumgehen der Vorderfüße UM die Hinterhand, welche ebenfalls auf einer Stelle bleibt: dabei ist das Pferd aber auf der Vorhand wie von Natur aus, das heißt, dass 60% seines Gewichts lasten auf den Vorderbeinen.
Die Terre-a-Terre-Pirouette ist die 3.Art: eine Wendung ÜBER der Hinterhand, bei der das Gewicht des Pferdes komplett auf den Hinterbeinen liegt. Die Skizzen der Hufspuren sind zwar fast gleich bei allen drei Arten, doch der Kreis des Gesäßes bei der Terre-a-Terre-Pirouette wird ja gar nicht abgebildet! Man könnte diese Wendung auch als Mittelhandwendung bezeichnen, um sie von der Hinterhandwendung UM die Hinterhand, und der AUF der Hinterhand zu unterscheiden.

Wenn die alten Reiter eine Terre-a-Terre-Wendung vom ersten Hufschlag aus machen wollten, führten sie zunächst das Pferd 2 bis 3 Sprünge seitwärts parallel zur Bande vom Hufschlag weg und leiteten die Terre-a-Terre-Wendung erst in der Bahn ein.
Also nochmal, weil es so wichtig ist: wenn man eine Terre-a-Terre-Pirouette ausführen möchte, darf man dies keinesfalls auf dem ersten oder zweiten Hufschlag an der Bande tun, denn das Pferd muss dazu ja sein Gesäß über seinen Hinterhufen weit zurück schieben und würde dann damit gegen die Bande prallen!
Wie so häufig gab es aber auch diesmal ein Glück im Unglück: ich mache sehr selten Handarbeit, meist nur wenn ich nicht reiten kann/darf, zuletzt vor einem Jahr. Gleich beim ersten Mal überraschte Picasso mich nun mit einer schönen Mezair, die sich zu meinem Erstaunen wie von selbst in einen Terre-a-Terre an der Hand drehte! Dies war ganz anders als ich es mir vorgestellt hatte, er drehte nämlich seine Hinterhand von mir weg und ging ganz entspannt im Terre-a-Terre seitwärts mit der Vorhand zu mir, ganz von allein! Es war also wieder mal so wie immer bei uns: was das Pferd unter dem Sattel gelernt hat, kann es dann an der Hand ohne das Reitergewicht umso leichter ausführen!
Update Ostern 2022 (während meiner Omikron-Quarantäne):
Pirouette, Terre-a-Terre und Galopp
DIE Pirouette ist eine Wendung des sehr erhobenen Pferdes auf dem inneren Hinterfuß, welcher stehenbleibt und seinen Platz nicht verlässt: das andere Hinterbein tritt dabei sehr dicht über und um das stehende.
Alle anderen als Pirouette bezeichneten Lektionen sind keine echten Pirouetten, sondern entweder Wendungen auf, über oder um die Hinterhand, oder Wendungen auf einem kleinen Kreis = Volten.
„Terre-a-Terre in der Länge des Pferdes“ bedeutet, dass die beiden Spuren der Vorderfüße einen Kreis mit dem Durchmesser der Pferdelänge bilden: dies ist nur deshalb möglich, weil das Pferd „über der Hinterhand“ ist, das bedeutet, dass die Hinterhufe gleichzeitig die Mitte des Kreises und
des Pferdekörpers darstellen: diese Lektion kommt der echten Pirouette genauso nahe wie die
Lektionen der Courbetten- und Mezair-Pirouette. In der (salopp ausgedrückt) „Terre-a-Terre-Pirouette“ bewegt das Pferd seinen Körper (und den Reiter darauf) so weit zurück, dass sich der Sattelgurt über den Hinterfüßen befindet. Anders dagegen bei der Umwandlung vom Schritt-Seitwärts (80-85°) in Form des Croupe-au-mur dicht an der Wand: hier bleiben Pferdekörper und Reiter gleich entfernt von der Wand, hierfür muss das Pferd in der Lage sein, seine Hinterhufe so weit nach vorn zu bringen, dass sie unter dem Sattelgurt fußen.
Wenn das Pferd all diese pirouettenartigen Lektionen beherrscht, hat der Reiter gelernt, die richtigen Signale zu geben. Welche Lektion es wird, entscheidet das Pferd unmittelbar vor dem Abheben der Vorderfüße: als ich vor 5 Jahren begann, in diese Richtung zu forschen, startete ich immer mit einer geraden Levade, die ich dann durch Anlegen des äußeren Zügels in eine Drehung des Pferdes auf seinen Hinterbeinen verwandeln konnte. Je nachdem, ob es eine hohe Levade oder eine niedrige war, entstand eine Courbetten- oder eine Mezair-Pirouette: dabei hält das Pferd die Hinter- und Vorderfüße nebeneinander auf gleicher Höhe und setzt die parallel bleibenden Hinterbeine um den Drehpunkt nach. Hierbei sieht der Reiter stetig geradeaus durch die Ohren des Pferdes und das Pferd ist äußerst wenig gebogen, fast komplett gerade.
Nimmt der Reiter dagegen zunächst den inneren Zügel an den Hals des Pferdes und zieht ihn über den Widerrist auf die Gegenseite, und sitzt er so weit vorn wie möglich, sodass sein Bauch beinahe die vordere Galerie berührt (ohne mit dem Oberkörper nach vorn zu fallen), und legt er im Moment des Anhebens der Vorhand dabei seinen äußeren Oberschenkel vorn etwas an, indem er sein äußeres Becken etwas nach vorn führt und tritt ganz minimal in den äußeren Bügel, dann wird es eine „Terre-a-Terre-Wendung in der Länge des Pferdes“ (salopp ausgedrückt: eine „Terre-a-Terre-Pirouette“). Dabei gehen die inneren Beine des Pferdes vor den äußeren und bilden so jeweils einen größeren Kreis als die äußeren.
Hierbei sieht der Reiter geradeaus durch die Ohren des Pferdes (Solleysel) oder ganz wenig zur inneren Seite des Pferdekopfes/ nach vorn über die innere Schulter des Pferdes (Cavendish), oder aber (nach Ridingers Kupferstichen) der Reiter wendet seinen Kopf und Blick sehr weit nach innen.
Ist der Reiterbauch nicht weit genug vorn, entsteht so der „relevierte (= erhöhte) Terre-a-Terre“.
Bei der echten Pirouette gehen initial beide inneren vor den äußeren Beinen, dann aber kreuzt das äußere Hinterbein dicht über und um das innere Hinterbein. Sie entsteht, wenn der Reiter ganz gerade im völligen Gleichgewicht sitzen bleibt, und kurz vor dem Anheben der Vorhand beginnt, das Pferd mit äußeren Zügel in die Wendung zu schieben. Er darf dabei nicht zu sehr vorne sitzen, damit das Pferd sich in der Pirouette hoch genug erheben kann. (Cavendish: „Ist die Reiterhand hoch, geht das Pferd hoch, ist die Reiterhand tief, geht das Pferd tief“.)
Gibt der Reiter die Hilfen wirr, kann es zu einer Mischung der Terre-a-Terre-Pirouette und der echten Pirouette kommen: Reiterbauch nicht ausreichend vorn, und nur zögerliches Herausführen der inneren Hand, und zu frühes, zu starkes Zurückführen der Reiterhand nach innen (= Anlegen des äußeren Zügels) bei einem geraden Sitz führt zu einer echten, nicht sehr hohen Pirouette. Bemerkt aber der Reiter seine Fehler sogleich und bringt seinen Bauch dann nach vorn und legt mehr den inneren Zügel an, und tritt minimal in den äußeren Bügel, setzt das Pferd die Hinterbeine breit und bleibt dichter am Boden: so wird sie zur Terre-a-Terre-Pirouette. Erschrickt aber der Reiter, weil er nun nach hinten bewegt wird (da das Gesäß des Pferdes nach hinten geschoben wurde), und treibt das Pferd vorwärts, erhebt es sich daraufhin wieder mehr...
Cavendish schreibt, das Pferd müsse vor der Einleitung einer Terre-a-Terre-Wendung ganz zum Stehen kommen, da Galopp und Terre-a-Terre zwei ganz verschiedene Lektionen seien, manchmal macht er dies sogar in Form von zwei oder drei Falkaden.
Cavendish: „Ein Terre-a-Terre auf einem großen Kreis ist in Wirklichkeit ein Schulgalopp (petit gallop)!“ Großer Kreis hier als Synonym für eine geringere Abstellung als 80-85°.
Ein wichtiger Satz von Gueriniére, der mein inneres Bild des Terre-a-Terres geradegerückt hat: er schreibt, dass im Terre-a-Terre das Pferd die Hüften (hanches) nicht so weit unter seinen Körper nach vorn bringt wie im Galopp (er meint hiermit nicht die Hinterhufe, die dabei ja viel weiter nach vorn bis unter den Sattelgurt kommen!). Das heißt, dass wir in der gesamten Ausbildung zwar als Hauptziel darauf hin arbeiten, dass das Pferd immer weiter auf die Hüften kommt/auf die Hüften gesetzt wird, dies aber im Terre-a-Terre wieder etwas reduziert wird: ein ganz anderes Ziel und Gefühl beim Terre-a-Terre!
Für die Falkade gilt genau dasselbe, und da die Falkade eine Vorstufe für die gerittene Kapriole ist, ebenso für ihre Einleitung, und ebenfalls für die Falkade zur Auslösung der Carriere.
Gueriniére schreibt als Einziger über den Terre-a-Terre: „Wenn man keinen keinen Triller („fredon“) der Hinterhand sehen kann, ist es kein Terre-a-Terre, sondern Galopp (ein schlechter, niedriger).“
Er leitet seine Lektion, die hier erstmals als Galopppirouette bezeichnet wird, ein, indem er nach einer halben Parade im Galopp die Hinterfüße immer weiter in die Volte bringt, bis sie in der Mitte einen kleinen Kreis gehen mit einer Abstellung von ca. 70°. Hier stellt sich die Frage ob er dann so weiter macht, also so galoppiert, wie die noch heute als Galopppirouette bezeichnete Lektion geritten wird, oder ob er tatsächlich daraus in die echte Pirouette wechseln kann, bei der das Pferd sich auf dem inneren Hinterfuß dreht.
Seine Passade erhält zwei Demi-Volten im Galopp am Ende der langen Seite, ähnlich einem Aus-der-Ecke-kehrt („a soldatte“ wie La Broue sie bezeichnet) : diese leitet er mit nur einer halben Parade ein, da sich die Gangart hier (im Gegensatz zur Benutzung einer Terre-a-Terre-Pirouette ) nicht ändert, und galoppiert dann im Schulgalopp im starken Kruppeherein mit einer Abstellung von ca. 70° zunächst parallel zur kurzen Wand weiter, wendet das Pferd dann. Der letzte Galoppsprung, der alle vier Füße des Pferdes gerade parallel zur Wand landen lässt, ist dann ein Terre-a-Terre-Schlag der Hinterhand.
In seiner Skizze auf Seite 135 verstößt er leider gegen seine eigenen Regeln, die er völlig zu Recht im Kapitel „Croupe-au-mur“ aufgestellt hatte, denn er lässt nun den Reiter das Pferd massiv in die Wand am Ende der langen Seite treiben: das Pferd muss deshalb, wenn es eine Verletzung durch den Aufprall verhindern will, zur Seite ausbrechen: ein schwerer pädagogischer Fehler, der das vielleicht bisher sorgsam erhaltene völlige Vertrauen des Pferdes in den Reiter schwer erschüttert! Obendrein wird das Pferd dann noch gelobt und belohnt, weil es eigenmächtig gehandelt hat! (Wenn es hinterher dann dieselbe Aktion im Gelände macht, steigt wohl der eine oder andere der schwachen Reiter, für die diese Aktion ja wohl nur gedacht ist, unfreiwillig ab!).
Deshalb sollte man diese Art der Demi-Volte im Schulgalopp immer nur so ausführen, dass die halbe Parade schon im Abstand von 3m vor der kurzen Wand gegeben, und das Pferd auf dem zweiten oder besser dritten Hufschlag in diesem starken Kruppeherein-Schulgalopp weit entfernt von der Wand geritten wird.
Seine „Pirouette in der Passage“ ist nicht eindeutig erklärt: Er schreibt, dass das Pferd zunächst eine Passage im Trab auf einem Hufschlag können muss (In seinem Kapitel Passage ist dazu erst einmal ein Trab zwischen den Pilaren erforderlich). Laut Skizze auf Seite 135 geht das Pferd dabei auf dem/um den inneren Hinterfuß in einer Abstellung von ca. 80°, da aber die Trabpassage immer vorwärts gehend sein muss, ein Schwebetrab auf der Stelle also unmöglich ist, kann es sich hier eigentlich nur um den Seitwärts-Trab (oder Schritt?) handeln, der von seinen Vorgängern auch als Passege/Passage bezeichnet wurde. (Der Seitwärts-Trab mit 80-85° Abstellung wurde wahrscheinlich erst ab ca. 1700 benutzt und hat den Nachteil, dass die meditative Wirkung des Seitwärts-Schritts dabei verloren geht: das Pferd wird zappeliger statt ruhiger.).
Auch hier stellt sich wieder die Frage, ob Gueriniére mit Trabpassage vielleicht gar nicht den heutigen Schwebetrab mit massiv verlängertem Anheben der Pferdebeine meint, sondern nur einen stark versammelten, sehr ruhigen Trab mit deutlich akzentuiertem, etwas verlängerten Anheben der Beine?
Update 18.04.2022:
In Guérinières Beschreibung des Terre-a-Terres stand auch (von mir zunächst ignoriert, da nicht verstanden) dass die Hinterhand des Pferdes dabei gespannt ist wie eine Feder.
Aber genau diese enorme Spannung der Kraft der Hinterhand ist es ja, die mir beim Treiben während der Falkade immer ein mulmiges Gefühl in der Magengegend bereitet! Diese Spannung ist ganz besonders bei Paco mit seinem kurzen breiten außergewöhnlich starken Rücken ausgeprägt, und ich habe schon seit vielen Jahren das Gefühl, dass besonders er immer darauf wartete, Carriere und Capriole zeigen zu dürfen.
Weil ich schon seit einigen Monaten spürte, dass der Versuch, eine Kapriole oder eine Carriere auszulösen, viel besser aus der Falkade als aus einer Levade gelang, hatte ich mich bereits langsam an diese herangetastet und inzwischen drei gerittene Kapriolen und viele Carrieren produzieren können.
Nun, mit meinem veränderten inneren Bild, werde ich testen, ob meine neue Vermutung stimmt: Treibt man das Pferd in der Falkade mit tiefgestellter Hand, triggert man eher eine Carriere; treibt man es dagegen in der Falkade mit hochgestellter Hand, wird es eher eine Capriole (lt. Solleysel ist dann eine Handbewegung hoch und runter, wie die eines Glöckners, erforderlich, wenn man mehrere Capriolen hintereinander produzieren will).
Die Terre-a-Terre-Pirouette hingegen macht mir dieses flaue Gefühl schon lange nicht mehr, weil ich sie schon so häufig und zuverlässig auslösen konnte (aber man weiß natürlich trotzdem, dass man dabei ganz in der Hand des Pferdes ist und sich völlig darauf verlassen muss!).
Es ist hier genau dieselbe Federspannkraft der Hinterhand vorhanden, die dabei allerdings ganz in die geschwinde Drehung umgesetzt wird.
Update 23.07.22 Der Hüftstütz um 1740

Angeregt durch dieses Bild versuche ich in den letzten Wochen, mit abwärts gehaltener Gerte die Auswirkungen des Hüftstützes besser zu verstehen.
Der Reiter auf dem Bild hält seine Zügelhand deutlich geöffnet in maximaler Supination mit zur Gegenseite zeigenden Fingermittel(=DIP)-Gelenken; seine andere Hand stützt sich auf seiner Hüfte ab, Zeigefinger vorn und Daumen hinten bilden ein V. Wird das Ellenbogengelenk so wie hier sehr weit nach hinten geführt, bringt dies seine linke Schulter sehr weit zurück, und wenn der Reiter dem durch den Druck des Daumens vorwärts in die Flanke entstehenden Reflex nachgibt, kommt sein Bauch noch mehr nach vorn und gleichzeitig der Oberkörper etwas weiter nach hinten. In dieser Haltung kann der Reiter seinen Körper incl. seines Beckens wie einen Baumstamm vor und zurück bringen, ohne dabei den Bauch einzuziehen, was eine extrem feinfühlige und sehr gleichmäßig dosierbare Einwirkung ermöglicht.
Durch die leichte Drehung des Oberkörpers nach links kommt der rechte Oberschenkel dichter und etwas weiter vorn an das Pferd, der linke Oberschenkel etwas weiter nach hinten: so entsteht die leichte Biegung des Pferdes nach links und deshalb kommt der linke Hinterfuß etwas weiter nach vorn: es entsteht eine Levade nach links.
Die Waden sind gestreckt mit einer deutlichen Außenrotation, die nur durch sehr kurze Sporen ermöglicht wird; der Reiter hat festen Kontakt in den Steigbügeln, die gespannten Waden wirken etwas hinter dem Gurt ein.
Der Reiter ist Linkshänder: seine Pistolentasche hängt links, der Ring an der linken Hand verhindert die Zügelhaltung mit der linken Hand. Der Degen ist trotzdem auf links geschnallt: damit er auf dem Bild als Statussymbol auftaucht? Oder auch, damit er dem eines anderen Reiters nicht in die Quere kommt, wenn dicht nebeneinander geritten wird?
Update 6. September 2022
Eine andere Variante des Hüftstützes findet man bei Georg Phillip Rugendas:

Der Reiter hält die rechte Faust mit den Fingernägeln nach unten während er eine Falkade auslöst. Dies führt dazu, das seine rechte Schulter minimal nach vorn kommt, was die Ausführung als Falkade (die ja immer schon die Möglichkeit des Abschießens in die Carriere beinhaltet) erleichtert, da sie die Vorhand ausgreifen lässt.
Würde der Reiter dagegen diesen Hüftstütz mit den Fingernägeln nach oben ausführen, käme die rechte Schulter weiter nach hinten und das Pferd würde mehr zur Ausführung einer Levade kommen: die Vorhand des Pferdes wird eher zurückgehalten.
Alle drei Varianten kann man prima auch während eines Ausrittes zur Sitzschulung benutzen, da es dann eher immer geradeaus geht und man die Dauer beliebig einstellen kann. Leider ist mein Sitz immer noch nicht so weit, dass ich Sporen ausprobieren könnte, deshalb reite ich immer noch nur mit der Gerte. Beim V-Hüftstütz ist das kein Problem, da ich sie bequem und sicher abwärts mit Mittel-, Ring- und Kleinfinger halten kann. Bei der Variante 3 mit Fingernägeln nach oben muss ich die Gerte allerdings schon waagerecht in der Mitte halten, da sie sonst zu schwer wird. Und Variante 2 mit den Fingernägeln nach unten bewirkt die unbequemste Gertenhaltung und hier wünsche ich mir am meisten, bald einen so guten Sitz erlangt zu haben, dass ich nie versucht wäre, die Sporen zu benutzen, um meine Sitzfehler zu überspielen = mir also endlich die Sporen verdient hätte.
Besonders gut erspüren kann man die Erleichterung der Pferdeschultern, wenn man im Schritt so auf der Vorhand durchs Gelände bummelt, wie La Broue es empfiehlt: die Gertenhand ergreift das Ende der Zügel, welche dann die Zügelhand loslässt, dann lässt der Reiter die Gertenhand mit den Zügeln absinken bis auf den Widerrist: wenn man jetzt abwechselnd Variante 2 und 3 anwendet, wird man (und auch das Pferd) so feinfühlig, dass ein weiteres und höheres Vorsetzen der Vorderfüße bei Variante 2 deutlich spürbar ist: sehr wertvoll bei Pferden, die zum Stolpern neigen. Man könnte sagen: " Das Pferd ist auf einer freien Vorhand".
Update 17.10.2022
Und wieder einmal muss ich alle Lektionen anders reiten als zuvor: es hat sich nämlich herausgestellt, dass das Bauch-vor eine entscheidende Hilfe ist, die (zumindest bei mir) erhebliche Auswirkungen auf die Leichtigkeit und Freiwilligkeit des Pferdes hat.
Die Schulung des Reitersitzes im Gelände mithilfe der verschiedenen Hüftstützvarianten bewirkt inzwischen, dass ich auch in der Reitbahn sehr häufig daran denke, die Schultergelenke zum Versammeln weit nach hinten zu führen; wenn man gleichzeitig die Zügelhand nur etwas höher nimmt, nimmt das Pferd deutlich mehr Anlehnung an die Kinnkette, die Vorhand wird leichter und geht höher, seine Schritte werden kürzer und die Hinterhand übernimmt mehr Last. Hat man allerdings nicht darauf geachtet, seinen Bauch nicht einzuziehen, bleibt alles irgendwie unbefriedigend. Fällt mir dann aber wieder ein, dass ich ja möglichst meinen Bauch jederzeit, und in allen Lektionen nach vorn halten möchte und schiebe ihn ein wenig vorwärts, geschieht ein kleines Wunder: das Pferd beginnt zufrieden zu schnauben und macht seine Lektion viel leichter, quasi von sich aus!
Durch das Training der verschiedenen Arten des Hüftstützes im Gelände habe ich jetzt herausgefunden, dass sich das Pferd im V-Hüftstütz versammelt, wenn man dabei seinen Daumen in seinen eigenen Rücken (Druckrichtung nach vorn) schiebt: dies funktioniert ähnlich wie das Versammeln beim Fausthüftstütz mit den Fingernägeln nach oben.
Schiebt man dagegen im V-Hüftstütz seinen Zeigefinger in seinen Bauch (also nach hinten) ergibt sich eine ähnliche Wirkung wie durch den Fausthüftstütz mit den Fingernägeln nach unten: nämlich eine Befreiung der Vorwärtsbewegung der Vorhand, also ein Zulegen des Pferdes, weil die Schultergelenke des Reiters dabei minimal nach vorn kommen. All diese Auswirkungen sind aber nur dann richtig wirksam, wenn der Reiter dabei seinen Bauch nicht einzieht!
Am deutlichsten zeigen sich diese Effekte beim Durchparieren und im Seitwärts/der Passege: bei beiden nimmt das Pferd nicht mehr den Kopf tief, sondern behält ihn besser oben, so wie es die alten Bilder zeigen.
Mein derzeitiger Wunschsitz ist also jetzt zusammengesetzt wie folgt:
1. Die Füße des Reiters nehmen eine feste, leichte, gleichbleibende Anlehnung in der Bügeln in der Weise, dass die Kraftlinie von Fuß bis Kopf nicht im Kniegelenk abbricht.
2. Die Hände werden mit den Handflächen deutlich nach oben gedreht gehalten (häufig maximal supiniert) in der Weise, dass die Fingermittelgelenke (= PIP-Gelenke) beider Hände zueinander zeigen.
3. Die Ellenbogengelenke des Reiters werden so weit vom Oberkörper abgehalten, dass eine deutliche Lockerheit im Pferderücken spürbar wird (10-20cm entfernt und immer ein klein wenig mehr als es für den Reiter bequem erscheint).
4. Der Reiter sieht niemals nach unten, sondern immer durch die Ohren des Pferdes nach vorn. Er nimmt niemals durch eine Kopfdrehung auf die Kreislinie die Bewegung des Pferdes vorweg, sondern stellt zuerst den Pferdekopf des Pferdes auf die Kreislinie ein und richtet nur dadurch seinen Blick über die Kreislinie, dass er durch die Ohren des Pferdes sieht.
5. In allen Übungen vermeidet der Reiter strikt, auf irgend eine Weise seinen Bauch einzuziehen: dieser soll immer entspannt nach vorn zeigen! Auch ein Zulegen oder Versammeln darf niemals zum Einziehen des Reiterbauches führen.
6. Ein Versammeln wird einzig und allein eingeleitet durch ein betontes Zurückführen der Schultergelenke des Reiters (welches seine Schulterblätter hinten zusammenführt und den Brustkorb nach vorn schiebt („Aufrichten der Vorhand des Reiters“) im Zusammenspiel mit einem leichten Anheben der Zügelhand (die Anlehnung der Reiterhand wechselt vom Mundstück zur Kinnkette): dabei wird die Zügelhand eher minimal nach vorn geführt..
7. Ein Zulegen und Verlängern des Pferdes wird einzig und allein durch ein minimales Vorwärtsbringen nur der Schultergelenke (nicht des Oberkörpers!) in Zusammenhang mit einem Absinken der Zügelhand (also einer Anlehnung der Reiterhand an das Mundstück, weg von der Kinnkettenanlehnung) ausgelöst: dabei wird die Zügelhand minimal nach hinten geführt..
8. In allen Lektionen bleibt dies die anzustrebende Grundhaltung des Reiters oberhalb der Knie: ur gelegentlich wird in dieser Haltung der eine oder der andere Oberschenkel etwas näher an das Pferd gebracht, die Position der Schultergelenke und die Höhe der Hände ändern sich natürlich auch bei Bedarf; kein Nachvorn- oder Nachhintenfallen des Oberkörpers (letzteres sehr schwierig in der Carriere!). Nie darf es zu einer Unterbrechung der senkrechten Kraftlinie im Reiterkörper durch fehlerhaftes Abknicken in den Kniegelenken kommen. Dies alles führt dann dazu, dass der Reiter genauso sitzt wie auf den alten Bildern vor 1789: den Oberkörper etwas nach hinten gebogen. Und wenn man „etwas“ Bauchansatz hat, so wie ich, dann gleicht der Sitz dem des alten Braunschweiger Herzogs (Reiterdenkmal vor dem Braunschweiger Stadtschloss, s. meine Seite „Fundstücke“).
9. Zum Abwenden von einer geraden auf eine gebogene Linie führt man zunächst die Hinterhand des Pferdes nach innen, indem man seinen äußeren Ellenbogen etwas nach vor bringt. Dann schiebt man mit dem äußeren Zügel und dem äußeren Oberschenkel das Pferd nach innen.
Sollte das Pferd die Hinterhand danach zu weit innen halten, muss man zur Korrektur dagegen seinen inneren Ellenbogen etwas nach vor nehmen, was die Hinterhand herausführt, so lange, bis Vorhand und Hinterhand auf der verlangten Linie (oder ggf. auf den gewünschten zwei Linien) gehen.
Immer, wenn sein Pferd nicht gut geht, muss der Reiter sich nacheinander folgende Fragen stellen:
Als erste: ist mein Bauch weit genug vorn?
Als zweite: sind meine Ellenbogen weit genug von meinem Oberkörper entfernt?
Als dritte: Zeigen meine Fingermittelgelenke wirklich zueinander?
Als vierte: sind meine Hände wirklich ausreichend supiniert?
Als fünfte: Sehe ich wirklich immer durch die Ohren meines Pferdes und nehme ich wirklich nie meinen Blick oder gar den Kopf nach unten?

Bei dieser Art des Hüftstützes passiert es nach einer Weile, das die Finger nach vorn wandern und der Daumen sich hinten einhakt: das bringt dann wieder eine versammelnde Wirkung mit sich und der Reiter wundert sich im Gelände, warum sein Pferd nicht mehr locker vorwärts geht.
Update 06.11.2022
„Haltung bewahren!“ Diese Aufforderung an mich hört sich so leicht an, aber inzwischen wird mir klar, dass wahrscheinlich für lange Zeit nicht die Frage ist, OB ich die Haltung verliere, sondern WANN, und genauer gesagt: WIE OFT innerhalb einer Reiteinheit! Nur zwanzigmal während eines 40minütigen Ausrittes ist zur Zeit schon eine sehr gute Leistung!
Eine andere Redewendung, die auch ihren Ursprung in der Reiterei haben könnte: „Jemand hat bei einer Sache den Daumen drauf“. Simon Georg Winter (Adlersflügel) zeigt nämlich, dass er normalerweise nicht den Daumen auf den Zügeln hält, wie wir es ja leider alle gelernt haben: reitet man mit einer Kandarenzäumung, darf die Zügelanspannung bei weitem nicht so stark sein wie bei der Trense oder dem Kappzaum.

Update 26.11.22: Das Richtige im Falschen
Seit einigen Tagen freute ich mich, dass ich das Pferd mit dem Pinky-Push einer Hand wunderbar leicht und sanft biegen konnte: Beim Bummeln auf der Vorhand am langen Zügel im Gelände fand ich heraus, das der Pinky-Push der Gertenhand (mit den Zügeln darin) das Pferd dazu brachte, sich zur Gegenseite zu biegen: Pinky-Push der rechten Hand > Biegung des Pferdes nach links, durch vermehrte Belastung des linken Sitzbeines. Der Pinky-Pull der rechten Hand dagegen brachte zuverlässig ein Biegen nach rechts.
Allerdings habe ich heute erkannt, dass ich Guérinières Anweisung zum Bummeln: „Die Gertenhand ergreift das Ende der Zügel, die Zügelhand gibt diese frei, und der Reiter lässt die Gertenhand (mit den Zügeln ) auf den Widerrist sinken“ falsch interpretiert hatte. Ich hatte angenommen, dass ich einfach wie immer die Zügelnaht/-schnalle von oben ergreifen solle, so dass die Zügel dann quer durch die Handfläche laufen. Heute erst ist mir klar geworden, dass diese Haltung ja ein Einrollen der Schulter auf der Gertenseite produziert, weil sich so eine Pronation der Hand ergibt wobei der Handrücken oben ist (das Gegenteil der erforderlichen Supination), und die Fingermittelgelenke nach vorn zeigen!
Ab jetzt halte ich die Zügel auch beim hingegebenen Zügel so wie normalerweise auch, sodass eine kleine Schlaufe oberhalb der Zügelfaust entsteht. Leider lässt sich nun aber die Gerte in dieser Hand nicht mehr abwärts halten, ohne die Handhaltung zu verfälschen. Ab jetzt also: entweder Gerte nach oben, wenn die Gerte in derselben Hand gehalten werden soll, oder die Zügel mit der anderen Hand halten!
Es ergibt sich daraus noch eine Änderung: Pinky-Push und Pinky-Pull einer Hand erzeugen nun eine prompte und sanfte Biegung zur anderen Seite als vorher.
Update 08.01.23
Als im Dezember bei -12°C die
Hufspuren auf den Paddocks gefroren waren und die Pferde dort fast
gar nicht gehen konnte, ließ ich Picasso in der Halle frei ohne
Halfter laufen, nach dem Training an der Hand mit dem Kappzaum.
Inspiriert durch die wunderbare
Weihnachtsvorstellung der Hofreitschule Bückeburg Mitte Dezember mit
einem Anteil an Freiarbeit probierte ich einmal aus, wie er wohl
reagieren würde, wenn ich, vor ihm stehend, meine Arme in derselben
Weise hoch nehme und mich dabei so bewege, wie ich es erfolgreich bei
der Handarbeit mache. Und siehe da, er machte eine schöne Levade,
völlig frei!
Dann lief er gesellig auf einem
ordentlichen kleinen Zirkel im Galopp um mich herum, ganz so, als sei
er an der Longe. Als ich ihn mit meiner Körperhaltung durchparierte,
fiel er mit der Hinterhand aus und stand dann ganz gerade mit dem
Kopf zu mir. Auf ganz wenige Signale von mir machte er dann drei
saubere Terre-a-Terre Sprünge zu einer Seite, dann eine Levade, dann
drei Terre-a-Terre Sprünge zur anderen Seite, immer mit dem Kopf zu
mir! Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk von ihm!
Update 16.03.2023
Nachdem ich für einige Monate den obigen Hüftstütz (17.10.22) ausprobiert hatte, war ich in der Lage, das untenstehende Bild richtig zu deuten:
Dieses Bild zeigt eine Verfeinerung des Hüftstützes: der Reiter demonstriert, wie er die Gerte mit dem langgestreckten Zeigefinger unterstützt: dies führt neben dem Hauptzweck des Hüftstützes (die Schultergelenke des Reiters nach hinten und das Brustbein des Reiters nach vorn zu bringen), zu einem noch weiteren Vorführen der Gertenhandschulter, welche nun wirklich gar nicht mehr gegenüber der Zügelhandschulter zurücksteht, ja sogar gelegentlich weiter vorzustehen scheint!
Damit fühlt sich mein Sitz nun fast symmetrisch an! Ich bin zuversichtlich, dass ich ab jetzt auch mit aufwärts gehaltener Gerte davon profitieren werde, und habe nach wenigen Tagen schon das Gefühl, dass das Pferd viel genauer auf noch feinere Hilfen reagiert!
Update 24.03.2023
Hier ein Hüftstütz ohne Gerte bei Ausführung der Schulparade:
Griechenland, um 1900 (?)
Mithilfe der verschiedenen Arten des Hüftstützes habe ich inzwischen ein deutlich besseres Gefühl für den Erfolg von Hilfen für meine Körperhaltung bei einhändiger Zügelführung auf Kandare und verstehe jetzt eine weitere Hilfen-Kategorie besser, die auf folgenden Darstellungen auftaucht:
Rubens zeigt auf dieser wunderschönen Darstellung der Auslösung einer Carriere den Einsatz von rechtem Arm und rechter Hand als Gegenmittel gegen die Auswirkungen der Oberkörperverdrehung des Reiters: das Wegführen der rechten Hand weit weg vom Pferd. Diese Hilfe für den Reiter bewirkt obendrein ein noch deutlicheres Vorschieben des Brustbeins: nun sitzt man wirklich wie ein Fürst! Hier kann zusätzlich durch mehr oder weniger Supination eine sehr feine Einwirkung auf die Biegung des Pferdes ausgeübt werden.
Pieter-Paul Rubens, Museum Genua
Zusätzlich zu sehen sind hier der „Pinky-Push-Maximus“ des rechten Kleinfingers (genau wie beim Hengst Pompeux in der Kapriole, im Rosenborgmuseum von Kopenhagen), und das Abhalten des rechten Zügels mittels des ausgestreckten linken Kleinfingers.
Delfter Fliese
Zum selben Thema:
Eine andere, ebenso wirksame Hilfe für den Reiter ist das Halten eines Gegenstandes in der rechten, vom Körper weggeführten Hand, so wie auf diesen Bildern:
Und ganz ohne Gegenstand oder Zügel geht es bei Marc-Aurel, der nur die Luft mit dem rechten Handballen wegzuschieben scheint und auch damit sein Brustbein vor- und seine Schultergelenke zurück führt:
Die Zügelhand produziert hier übrigens die wichtigste Hilfe für das Seitwärts und den Terre-a-Terre: der um-sich-herum-biegende innere Zügel hält die Vorhand des Pferdes zurück, was die Hinterhand einwärts (= in die Bewegungsrichtung) schwenken lässt.
Update 07.04.2023
Die Gertenhaltung a la Duchatel nutze ich inzwischen sehr häufig zur Disziplinierung meines Sitzes bei aufrecht getragener, in der Hohlhand endender Gerte: sobald ich den Verdacht habe, dass mein Brustbein und mein Bauch nicht weit genug vorn sind, nehme ich die Gerte herunter in diese Art des Hüftstützes, und fast immer bemerke ich eine starke Korrektur meiner Oberkörperhaltung! (Mit der Gerte in der linken Hand ist das allerdings noch ein mühsamer,langsamer Wechsel: um ihn auch auf dieser Seite geschmeidig und schnell ausführen zu können, wird es wohl noch ein paar Monate dauern..).
Der recht weit nach außen abgestreckte Gertenarm ist inzwischen auch eine lieb gewonnene Art meiner Sitzschulung: ich halte die Gerte an ihrem Schwerpunkt (sie steht dann ca. 2/3 über der Gertenhand und 1/3 befindet sich unterhalb) so weit ab, wie der Braunschweiger Herzog seine Rolle auf diesem Bild hält:

Hat man dies einige Male geübt wird dem Reiter klar werden, dass man bei aufrecht getragener Gerte nicht unbedingt die Gertenhand dicht gegenüber der Zügelhand halten muss: man kann sie auch etwas weiter weg, ebenso supiniert mit zur anderen Hand zeigenden Fingermittelgelenken (DIPs), halten und sich sogar freier, stabiler und deshalb sicherer fühlen.
Beide neuen Arten der Körperhaltungsverbesserung bringen die Füße des Reiters fester und ruhiger in die Steigbügel, vor allem wenn er gelernt hat, so gut wie gar nicht mehr seine Fersen und Beine zum Treiben einzusetzen, weil sein Pferd „von der Hand angeht“:
alle alten Meister verlangten ja von einem ausgebildeten Pferd, es solle „von der Hand angehen“, also durch kurzes Zupfen an den Zügeln, möglichst ohne (bzw. ohne große, sichtbare) zusätzliche Einwirkung von Schenkeln, Gerte oder Sporen.
Dies ist mir nun, mit zunehmender Sicherheit im Sitz der alten Meister eher möglich.
Die Kunst besteht darin, die Zügelhand dabei genau in der richtigen Höhe zu halten: möchte man nur ein einfaches Angehen bzw. einen einfachen Wechsel in eine höhere Gangart, wird der Reiter die Zügelhand eher tief halten: so wirkt hauptsächlich das Mundstück und weniger die Kinnkette ein und das Pferd streckt sich eher vorwärts abwärts. Hält man die Zügelhand hoch, wird das Pferd eher in die Höhe angehen, z.B. mit einem vermehrten Anheben der Vorhand im Galopp, und im Extremfall eine Lektion auf der Stelle ausführen, z.B. eine Falkade, Carriere oder Kapriole, weil es sich durch die Einwirkung der Kinnkette dabei eher aufrichtet und sein Schub nun nicht vorwärts sondern aufwärts gerichtet ist.
(Hebt man die Zügelhand höher, ist es häufig erforderlich, sie dazu etwas weiter von sich weg nach vorn zu schieben, damit dabei kein Energieverlust in der Pferdebewegung entsteht).
Besonders feinfühlig muss der Reiter beim Auslösen einer Terre-a-Terre-Pirouette sein: Hierbei bleiben die Hinterfüße im Zentrum und der Pferdekörper schiebt sich über dieses nach hinten, bis sich seine Hinterfüße genau unter der Mitte des Pferdes befinden. Wird sie als Kampflektion ausgeführt, sollen die Vorderfüße allerdings dicht über dem Boden kreisen, deshalb muss die Reiterhand tief stehen. Hier kommt also eher keine aufrichtende Wirkung zustande, und deshalb muss das Pferd diese Lektion ganz von allein ausführen: es muss an zusätzlichen Reitersignalen erkennen, dass eine Terre-a-Terre-Pirouette gewünscht wird: leichter Druck auf den äußeren Bügel, beim Zupfen an den Zügeln zunächst blitzartig ein minimales Touchieren des inneren („um sich herum biegenden“) Zügels am Hals, sofort gefolgt von einem etwas eindringlicheren Anlehnen des äußeren („von sich weg schiebenden“) Zügels, zusammen mit einem starken Vorschieben des Reiterbauches und einem Rückwärts-Lehnen des Reiteroberkörpers.
Während der Reiter zum Training des Terre-a-Terres und der Terre-a-Terre-Pirouette kaum nach innen sehen und seinen Oberkörper nur minimal nach innen drehen soll, ist es im Kampf aber erforderlich, seinen Gegner anzusehen und sein Schwert einzusetzen: das untenstehende Darstellung zeigt, dass dieser Reiter den Terre-a-Terre dazu mit einer wieder anderen Art der Handhaltung einübt.

Gesehen im Schloss Blois, 17. Jhdt., Öl auf Marmor (!)
Update 01.06.2023
Heute habe ich Paco zum ersten Mal in diesem Jahr wieder zur Weide geritten. Seit 8 Jahren bin ich stolz darauf gewesen, mich vom Erdboden aus auf ihn schwingen zu können, auf eine lose auf seinen Rücken gelegte Satteldecke, und ihn mit am Stallhalfter eingeknotetem Führstrick als Zügeln zur Weide reiten und teils galoppieren zu können.
Heute unter etwas erschwerteren Bedingungen als sonst üblich: Der Urin der rossigen Stute, die ihn am Putzplatz vor 3 Tagen anpinkelte war für ihn immer noch zu riechen, was ihn natürlich etwas aufregte, und ein sehr junges Fohlen tobte auf einem Paddock. Dazu ein nächtlicher Temperatursturz von 20° und obendrein ein Bagger, der seit 2 Tagen neben Stall und Wiesen arbeitet. Deshalb musste ich zum Abbremsen vor der Weide sehr stark an den Strick-Zügeln ziehen, aber selbst das half nicht: erst durch extremes Herumziehn seines Kopfes zu einer Seite konnte ich ihn zum Anhalten bringen, sonst wäre er vorbei galoppiert!
Dadurch wurde mir klar, wie weit ich mich inzwischen von jeglichem Am-Zügel-Ziehen zum Abbremsen entfernt hatte: Ich benutze seit ca. 16 Jahren keine Wassertrense, seit mindestens 6 Jahren keinen Kappzaum mehr (die eine Woche mit den Versuchen, die innere Kappzaumleine à la Cavendish nur zum Stellen und Biegen anzuwenden, ausgenommen), und ziehe deshalb auch nicht mehr an beiden Kappzaumleinen/Trensenzügeln zum Abbremsen, und so wurde mir heute klar, wie sehr ich die erreichte Leichtigkeit meiner Hilfen torpedieren und wieder verlieren würde, wenn ich wieder das Stallhalfter zum Durchparieren einsetzte! Ab jetzt also selbst das zur-Weide-Reiten nur noch mit Kandarenzäumung, oder zu Fuß gehen!
Falls ich noch einmal ein Pferd einreiten werde, steht für mich immer mehr fest, dass ich dann auf die alten Meister hören werde: „ Die Benutzung einer Wassertrense ist eine Dummheit!“ (William Cavendish), sowie: “Der Einsatz des Kappzaums ist strikt abzulehnen, weil dadurch sowohl Pferd als auch Reiter zum Ziehen an den Zügeln gebracht und beide deshalb verdorben werden“ (Gueriniére); und nur gelegentlich einzig den jeweils inneren Zügel eines Kappzaums verwenden werde (Cavendishs neue Methode), ganz im Sinne von La Broue, der immer wieder warnte: "Der Kappzaum ist einzig und allein dazu da, dem Pferd die Absicht der Kandarenhilfen zu erklären!" (soll heißen: nicht zum Reiten, also Bremsen, Lenken oder Formgeben des Pferdes!).
Für die vorbereitende und begleitende Arbeit mit dem Kappzaum vom Boden aus gilt dann ebenso: zulässig ist hier einzig und allein der Druck des Kappzaumes auf den äußeren Nasenrücken, sowohl beim Longieren, als auch bei der Boden- und Handarbeit; ein Bremsen und Zurückhalten des Pferdes durch Anzug beider Kappzaumzügel dagegen ist äußerst kontraproduktiv für das Reiten, deshalb müssen hierzu andere Hilfen (Körperhaltung des Menschen, Gertenhaltung etc.) eingesetzt werden, um das Pferd nicht zu verderben!
Update 17.07.23(Im Folgenden ist die Zügelhand die linke).
Bei einhändigen Reiten auf Kandare fällt dem Reiter die Biegung des Pferdes zur Zügelhandseite viel leichter, weil der Hebel des Kleinfingers, der den linken Zügel anzieht viel stärker ist als der durch den Ringfinger. Obendrein besteht zwangsläufig die Tendenz, die Zügelhand zu ihrer Seite des Widerristes zu nehmen, was dazu führt, dass der Reiter die gleichseitige Schulter und den gleichseitige Oberkörper mehr nach vorn hält als die andere. Dies führt dann meist zu einer Biegung des Pferdes zu dieser Seite, sichtbar z.B. als ein Schwenken der Kruppe zu dieser Seite (hier die linke).
Wegen der Neigung der Zügelhand (eher etwas mehr links vom Widerrist zu stehen), muss für ein sehr betontes Kruppeherein nach links bei fast gerade gehaltenem Kopf und Hals, wie es für das Seitwärts oder den Terre-a-Terre nach links erforderlich ist, die Zügelhand sehr weit nach rechts über den Widerrist geführt werden, um einen stark um sich herum biegenden, linken Zügel zu erzeugen, der die Kruppe gut nach links herein schwenken lässt.
Für ein sehr betontes Kruppeherein nach rechts bei fast gerade gehaltenem Kopf und Hals, wie es für das Seitwärts oder den Terre-a-Terre nach rechts erforderlich ist, muss dagegen die Zügelhand nur wenig weiter nach links geführt werden: man kann fast allein durch leichtes Anziehen den stark sich herum biegenden, rechten Zügel erzeugen, denn die Zügelhand steht ja `eh schon etwas links vom Widerrist.
Dies rächt sich dann allerdings beim normalen Stellen und Biegen des Pferdekopfes nach rechts: schon ein leichtes Anziehen/Zupfen des rechten Zügels wird vom Pferd leicht als ein um sich herum biegender Zügel interpretiert und so schwenkt es seine Kruppe nach rechts einwärts, und wegen der geringeren Zügelkraft des linken Mittelfingers hat der Reiter kaum eine Möglichkeit, die Biegung des Halses nach rechts zusammen mit dem notwendigen Nach-Innen-Schieben der Vorhand mithilfe des linken Zügels zu erreichen.
In so einer Situation sollte man den rechten, inneren Zügel nur anziehen/zupfen, während er mit dem linken Kleinfinger etwas vom rechten Hals weg geschoben wurde: erst dann kann der äußere (als von sich weg schiebender Zügel) bequem und für das Pferd verständlich die Vorhand des Pferdes in die Volte schieben (Im Rubensbild aus Genua sieht man einen noch ausgestreckten Kleinfinger der Zügelhand, obwohl das Pferd bereits links gestellt ist. Wahrscheinlich führte er davor eine oder zwei gerade Falkaden aus, um das Pferd auf diese fulminante Carriere einzustimmen).
In einer Linksbiegung dagegen kann ein Stellen des Pferdekopfes nach links problemlos durch Zupfen am inneren, linken Zügel ausgelöst werden.


Antoon van Dyke (?) ca 1621-1627
(Bei dieser ungewöhnlichen Zügelhaltung benutzt der Reiter für die Schulparade dagegen den Ringfinger der Zügelhand zum Abhalten des rechten Zügels vom Pferdehals)
Hat man den linken Kleinfinger einige Wochen lang bei der Rechtsstellung und -biegung des Pferdes eingeübt, ist dabei schnell klar geworden, dass er (im Gegensatz zum Schritt und Trab) bei den heftigeren Bewegungen im Galopp nicht stabil einsetzbar ist: hier kommt nun Gueriniéres Einhaken des Kleinfingers der Gertenhand ins Spiel: er wird hierfür nur ganz leicht, wirklich nur zum Ersatz des minimalen Anziehens des rechten Zügels und als Ersatz des weghaltenden linken Kleinfingers angewendet: das Abhalten vom rechten Hals erfolgt nun automatisch. Achtung: dies verführt den Reiter anfangs leicht dazu, viel zu sehr am rechten Zügel zu ziehen, was kontraproduktiv wäre!
Die Verbindung der Gertenhand zur Zügelhand bleibt durch das kurze Stück des rechten Zügels vom rechten Kleinfinger zur linken Hand (in der der rechte Zügel wie gewohnt gehalten wird) sehr stabil, und der Reiter führt seine beiden Hände ganz synchron, als wären sie ein fester Block.
Hierdurch entsteht als Bonus ein Vorwärtsführen seines rechten Oberkörpers, so dass beide Schultern genau neben einander stehen.
Zweiter Bonus: Der entstehende leichte Zug der rechten Hand bringt die Zügelhand mühelos genau über die Mitte des Widerristes, ohne dass sich der Reiteroberkörper verdreht, eine wunderbare Haltungs- und Sitzschulung!
(Großer Nachteil: Ein Werkzeug (Schwert, Garrocha,etc.) mit der rechten Hand zu führen ist so nicht möglich, und auch fast alle Gertenbewegungen sind extrem behindert, deshalb ist das Einhaken des Kleinfingers in den rechten Zügel nur zeitweise angebracht).
Dieselbe gute Auswirkung auf den Reitersitz aufgrund der Koppelung der rechten Hand an die Zügelhand durch das kurze Stück des rechten Zügels kann ebenso erzielt werden durch ein Wegführen beider Zügelenden mit der rechten, supinierten Hand weit weg vom Pferd, wie man es z.B. im Rubensbild sehen kann: Der rechte Brustkorb des Reiters schwenkt nun genauso weit vor wie der linke und das Brustbein des Reiters wölbt sich nach vorn. (Dies geht auch mit Gerte, wenn man diese aufrecht trägt).
Rutscht der Reiter jetzt im Sattel so weit wie möglich nach vorn, nimmt seine Beine ebenfalls etwas nach vorn, verstärkt seine Anlehnung in den Steigbügeln und bringt seine Schultergelenke nach hinten, spürt er sofort ein Anheben der Vorhand des Pferdes und einen erhabeneren Gang der Vorderbeine: der perfekte Sitz ist erreicht!

Hier noch einige weitere Interpretationen des Nestier-Kupferstichs: er hakt den rechten Zügel nicht in den rechten Kleinfinger ein, sondern lässt ihn unter dem Mittelfinger durchlaufen: dies ermöglicht ein unendlich feines Spielen von rechtem Zeige- und Mittelfinger am rechten Zügel!
Er trägt nur an der rechten Hand einen Handschuh, für die Benutzung der im Moment durchhängenden einzelnen Leine, die mitsamt ihres Nackenbandes am Kinnkettenhaken und damit in das rechte Auge der Kandare eingehängt ist. Vermutlich ist das eine Abwandlung der „Neuen Methode“ Cavendishs: anstatt eine rechte Kappzaumleine in den rechten Ring eines Kappzaums einzuhängen, zieht er seine Leine und den rechten Kandarenzügel gleichzeitig an, was die Einwirkung der Kinnkette beim jungen Pferd verhindert, da so Ober- und Unterbaum gleichzeitig, mit derselben Kraft, und gleich weit nach hinten geführt werden, als schonende Vorbereitung auf die spätere alleinige Einwirkung des rechten Kandarenzügels zum Rechtsstellen.
Wie den meisten Pferden fällt auch diesem das Rechtsstellen schwer (es trägt wie die meisten Pferde seine Mähne links), deshalb braucht es nur dann gelegentlich eine Unterstützung durch eine innere Leine, wenn es rechts gestellt werden soll.
Update 28.07.2023: Meine neuen Ergebnisse zum Terre-a-Terre
Der Terre-a-Terre ist eine Gangart, bei der die Hinterfüße des Pferdes den Boden kaum verlassen, sich also in der geringst möglichen Höhe seitwärts über den Boden bewegen (= ital. „terra terra“). Dabei kommt es zu einem seitwärts Herumschwenken der Hinterhand mit zunächst nur einem Heranführen des äußeren Hinterfußes in Richtung des inneren, gefolgt/begleitet von einem raschen seitwärts Wegführen des inneren Fußes, der den Boden schon verlässt, bevor der äußere Hinterfuß aufsetzt (= „Triller der Hinterfüße“, der laut Gueriniere das Merkmal des Terre-a-Terres darstellt). Dadurch entsteht ein ganz kurzer Zeitpunkt, an dem beide Hinterbeine gleichzeitig in der Luft sind.
Die Vorhand des Pferdes rotiert etwas um die Hinterhand, was der innere Vorderfuß abfängt, indem er weit ausgestreckt vor greift. Danach rotiert die Hinterhand etwas um die Vorhand, was nun der innere Hinterfuß durch weites Vorgreifen abfängt.
Der unerfahrene Betrachter nimmt nur wahr, dass sich Vorhand und Hinterhand abwechselnd erheben und nennt den Terre-a-Terre deshalb zweitaktig.
Sieht man aber genau hin, entsteht ein Viertakt: Nach dem Breitstellen der Hinterfüße 1. Umsetzen der Vorhand. 2.Anheben des äußeren Hinterfußes, während der innere noch am Boden ist. 3. Anheben des inneren Hinterfußes, während der äußere noch in der Luft ist mit sofortigem Absetzen des äußeren (Triller). 4. Absetzen des inneren Hinterfußes, wonach die Hinterfüße wieder breit stehen. Das Pferd steht nun wieder in 85-90° quer zur Bewegungsrichtung mit weit außeinander stehenden Hinterfüßen.
Fehler treten auf, wenn der Reiter die Vorhand oder aber die Hinterhand zu stark voran treibt: entweder tritt dann der äußere Hinterfuß kreuzend über den inneren (dieselbe Bewegung wie beim Seitwärts-Schritt, der ja die Vorübung für den Terre-a-terre war) oder aber der äußere Hinterfuß setzt schon direkt neben ihm auf dem Boden auf, wärhend der innere noch nicht abgefußt hat.
Update 21.09.23
Beim Stöbern im „Französischen Kunstreiter“ stieß ich vor einigen Tagen glücklicherweise auf das Kapitel 19 in Band II. Hier erklärt La Brouer, dass man den Terre-a-Terre auch gut einüben kann, wenn man ihn in einen großen Zirkel einbaut. Ich habe bisher die Lektion Terre-a-Terre meist nur entweder seitwärts geradeaus, oder seitwärts auf der Volte, oder als Terre-a-Terre-Pirouette geritten (meistens erzeugt durch Anfeuern des Pferdes aus dem Seitwärtsschritt (der Passege)), was dem Pferd aber schnell langweilig und zu mühsam wird. Ihn weiter zu treiben macht wenig Sinn, zumal La Broue schreibt, ein „automatischer“ Terre-a-Terre, den beinahe schon ein 10-jähriges Kind reiten könnte, habe keine Eleganz und sei eher ein Dahinschleichen: er bevorzuge es, wenn das Pferd „über den Rücken“ ginge, auch wenn dies für den Reiter unbequemer ist.
Pferde sehen ja auch wohl in einer vollen 360°-Wendung keinen Sinn, und so bricht Picasso häufig nach einer ¾ Wendung ab.
Auf der Zirkellinie aber kann man die Kruppe voll herein schwenken, zwei bis drei Terre-a-Terre-Schläge machen, dann wieder auf die Zirkellinie zurück schwenken: die Herausforderung dabei ist, die Vorderfüße immer auf der Zirkellinie zu halten, und, falls aus dem Galopp ausgeführt, dabei nicht in den Trab zu fallen: das Pferd musste ja, um mit den Vorderfüßen auf der Zirkellinie zu bleiben, die Hinterfüße sehr viel weiter nach vorn setzen, und nun beim Zurückschwenken auf die Zirkellinie die Hinterfüße für den Galopp wieder weiter nach hinten nehmen!
Dies ist für La Broue eine wertvolle Lektion, weil es die Situation im Zweikampf widerspiegelt, in der man immer wieder die Stellung des Pferdes ändern muss.
Als Vorbereitung kann man es gut trainieren im Schritt-Seitwärts (der Passege): volles Hereinschwenken der Kruppe, dann zwei bis vier Seitwärts-Schritte, dann wieder Zurückschwenken auf die Zirkellinie, ohne dass die Vorderfüße die Zirkellinie verlassen. Das Pferd freut sich über die Abwechslung!
Vielleicht hilft mir die neue Lektion besser, herauszufinden wie hoch die Vorhand in ihren Schlägen kommen soll, denn ich habe gerade bemerkt, dass Ridinger zwar noch 1722 auf einem Kupferstich den deutschen Titel "Redopp" mit französisch "Terre-a-Terre" gleich setzt, aber 1760 zwei Kupferstiche "Redopp" einem dritten mit dem Titel "Terre-a-Terre“ gegenüber stellt: letzterer zeigt eine etwas weniger erhobene Vorhand mit weniger vorgestreckten Hufen. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass der Reiter, der Ridinger als Berater für die Stiche von 1760 zur Verfügung stand, nun mit „Redopp“ nur den relevierten (= erhobenen) Terre-a-Terre bezeichnete.
Weil ich mich immer so sehr freue, wenn Picasso den Terre-a-Terre bzw. die Terre-a-Terre-Pirouette gut ausgeführt hat, neige ich leider immer noch dazu, die Reiteinheit danach zu beenden und aus der Halle zu reiten. Das hat allerdings dazu geführt, dass er anfängt, Terre-a-Terre zu gehen wenn er keine Lust mehr hat und die üblichen 8 bis 15 min überschritten sind. (Vor einiger Zeit war beim Einreiten in die Halle ein unbekanntes Tier darin und er fing sofort an, den schönsten Terre-a-Terre zu gehen weil er gleich wieder raus wollte!).
Update 20.11.23 Will man das Pferd (und sich selbst) richtig umstellen, weg von durchhaltenden bremsenden Zügeln zum leichten, kurzen aber entschiedenen Zupfen für ein Zulegen, muss man auch im übrigen Umgang mit dem Pferd soweit wie irgend möglich ein Ziehen an den Kandarenzügeln zum Abbremsen vermeiden, um immer eine klare Sprache zu verwenden.
Deshalb darf man es dann am Boden nie mehr an einem oder an beiden Kandarenzügeln führen, sondern nur am Backenstück des Reithalfters (plus zusätzlicher Einwirkung der Körperhaltung des Führenden). Auf einigen Bildern von Philips Wouvermann sieht man diese sorgfältige Art, ein Pferd zu führen:
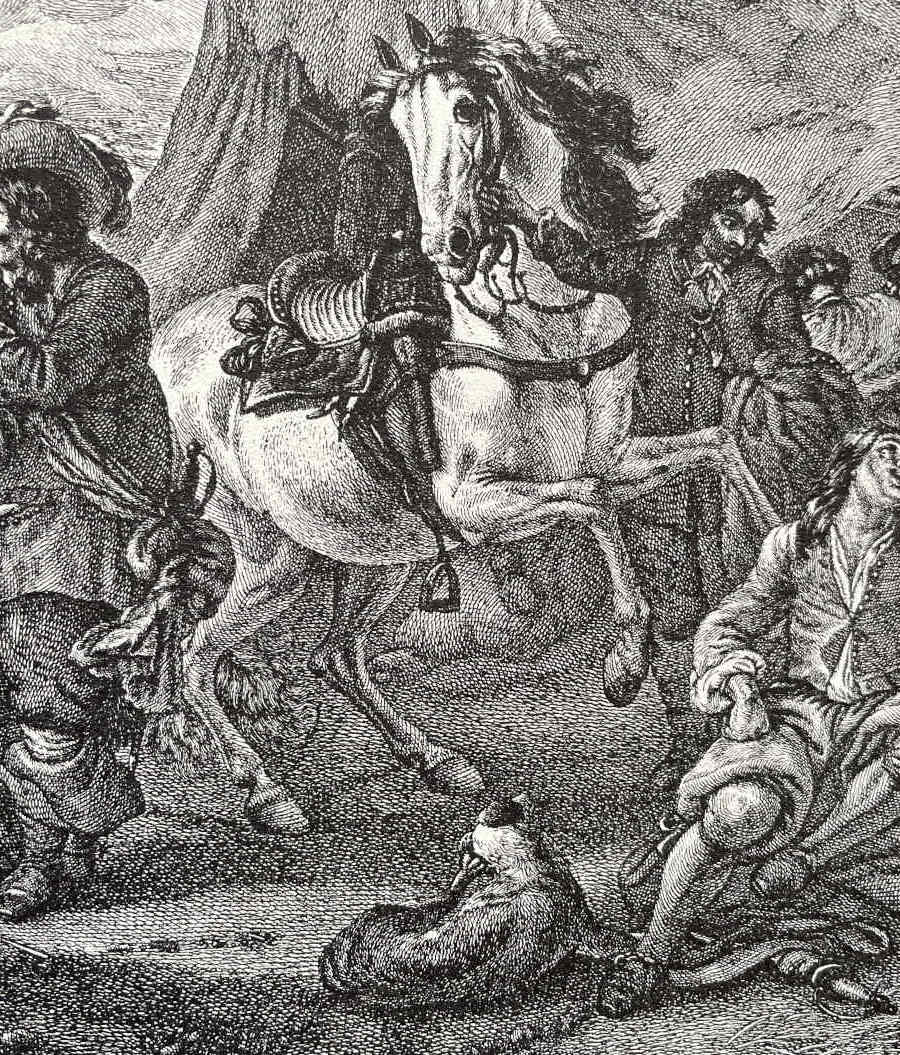
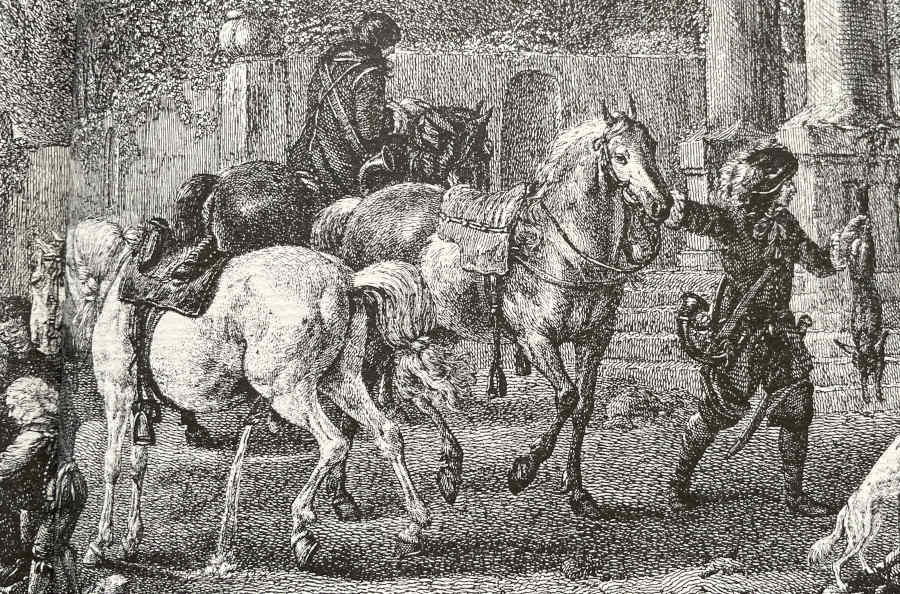
Ebenso darf man dann bei der Handarbeit nie mehr an einem Zügel, sondern nur noch mit beiden Zügeln in einer Hand über dem Widerrist arbeiten, und auch dabei nie die Zügel zum Abbremsen rückwärts ziehen, sondern für diesen Zweck die Hand nur anheben, damit das Pferd sich durch die Kinnketteneinwirkung versammelt und dadurch (im Zusammenspiel mit der Körperhaltung des Menschen) ein Abbremsen erreicht wird.
Das bedeutet für mich auch: ein Reiten auf Wassertrense und auf Kappzaum allein kommen nie mehr in Frage, und selbst eine Langzügelarbeit werde ich zumindest in nächster Zeit, evtl. sogar für immer, vermeiden bei einem Pferd, das einhändig auf blanke Kandare geritten werden soll, denn eine Umstellung auf Nichtziehen nimmt ja ( sowohl für das Pferd als auch für den Reiter!) viele Wochen oder Monate in Anspruch. Auch ein Einspannen vor der Kutsche würde m.E. einen Rückfall ins Ziehen beim Pferd erzeugen.
Das Zupfen zum Zulegen kann variiert werden: zupfe ich mit tiefer Hand und nehme ich am Ende des Zupfens die Hand etwas höher, resultiert ein Animieren des Pferdes mit gleichzeitiger Versammlung und einem Höhernehmen der Vorhand, dies kann beim Angaloppieren einen schönen Aufwärtsgalopp erzeugen, oder aus dem Stand eine Falkade mit sichelförmig nach vorn gehaltenen Hufen unetrstützen.
Zupfe ich an den Zügeln beim Vorführen des linken Vorderbeines, macht dieses einen längeren Schritt nach vorn, während das rechte etwas weniger stark nachfolgt, es sei denn ich zupfe gleich danach auch beim Vorführen des rechten Beines.
Wichtig für die Umstellung ist, dass das Pferd niemals mehr das Gefühl vermittelt bekommt, dass beim Anzug der Zügel ein Verlangsamen oder Stehenbleiben belohnt wird, und beim Reiter muss das Ziel der Umstellung sein, dass er niemals mehr zum Abbremsen an den Zügeln zieht. Diesen meist jahrelang antrainierten Reflex völlig zu verlieren ist genauso wichtig, wie lange zuvor den Reflex abgelegt zu haben, sich bei starker Unsicherheit an den Zügeln festzuhalten: Letzteres muss ja inzwischen undenkbar geworden sein, mit dem Ergebnis, dass man dann stattdessen immer automatisch in die Mähne greift zum Festhalten.
Inzwischen bin ich der festen Überzeugung, dass Gueriniéres Zulassen der Wassertrense zum Anreiten von jungen Pferden ein schwerer Fauxpas ist, der einerseits zustande kam, weil Solleysel bei seiner Cavendish-Übersetzung nicht im Mindesten erwähnte, dass Cavendish die Anwendung einer Wassertrense zum Reiten kategorisch als Dummheit einstufte, sondern Solleysel sie sogar im Gegenteil bei jungen Pferden empfahl (ganz offensichtlich kannte Gueriniére den englischen Originaltext nicht und konnte deshalb diese Lüge nicht erkennen.) Hinzu kam, dass damals die jungen Pferde fast immer von „jungen, mutigen Männern“ angeritten wurden: hier fiel es nicht so auf/bzw. ins Gewicht, wenn diese durch das Ziehen an den Zügeln als Reiter verdorben wurden. Gueriniére lehnt ja für seine Reitschüler den Gebrauch des Kappzaums aus diesen Gründen völlig ab.
Heute sind wir dagegen in der glücklichen Lage, zu aller erst eine exzellente Grundlage für das Anreiten mit einer sorgfältigen Boden- und Longenarbeit am Kappzaum legen zu können (wobei der Kappzaum hier ja nur zur Biegung des Pferdes, nie durchhaltend zum Abbremsen verwendet wird!), bevor sich zum ersten Mal ein Reiter darauf setzt.
Update 14.12.23:
Auch wenn ich mich seit 2016
autodidaktisch viel weiter zurück in die ursprüngliche alte
Reitkunst entwickelt habe als Bent, halte ich trotzdem noch sehr
viele seiner Aussagen und Herangehensweisen für richtig. Eine davon
ist seine Bezeichnung des olympischen fliegenden Galoppwechsels als
„Reiten Passgang“.
Weil ich bisher keine befriedigende
Art und Weise fand, einen richtigen Galoppwechsel zu erlernen, hatte
ich das bisher vermieden; sehr prägend dafür war mein Erleben der
vier Reitschulen in Paris-Bercy 2012 gewesen, bei der die Reiterin aus
Saumur eben diesen Passgang als Einerwechsel vorführte, und gleich
daneben ein spanischer Reiter einen Zweierwechsel zeigte, der
harmonisch und richtig aussah, auch weil das Pferd schön auf die Hüften gesetzt war.
Bei Paco hatte ich aufgrund seines
Alters (21 Jahre) die Hoffnung darauf aufgegeben und mache seit 2
Jahren mit ihm nur einen einfachen fliegenden Wechsel im Galopp per
Aus-dem-Zirkel-wechseln. Dieser macht ihm großen Spaß, auch weil er
merkt wie ich mich darüber freue!
Beim jetzt 14jährigen Picasso, den ich
ja mit einem viel größeren Vorwissen ausgebildet hatte, hatte ich
das nicht probiert, um ihn nicht zu verderben. Vor einiger Zeit aber
schöpfte ich neue Hoffnung, mit ihm endlich einen guten Fliegenden
Wechsel zu erlernen, als ich begriffen hatte, dass ich einige Schläge
Terre-a-Terre auf einem großen Zirkel aus dem Galopp reiten, und ihn
danach nahtlos wieder in den Galopp zurückbringen konnte: denn wenn
ich ihn z.B. aus dem Terre-a-Terre wieder zurück in den Rechtsgalopp
bringen konnte, müsste es ja auch möglich sein, einen Wechsel vom
Terre-a-Terre nach rechts in den Terre-a-Terre nach links auszulösen,
und dann aus diesem nahtlos in den Linksgalopp überzugehen. Ich
hatte ja gar keine Probleme, den Wechsel des Terre-a-Terres von einer
Hand zur anderen zu bewältigen, wenn ich ihn aus dem
Seitwärtsschritt gestartet hatte.
So übe ich jetzt den fliegenden
Galoppwechsel, indem ich durch die halbe Bahn wechsele, auf halbem
Wege zunächst die Hilfen für den Terre-a-Terre zur selben Seite andeute, dadurch stark abbremse und fast auf derselben Stelle bleibe,
dann die Hilfen für den Terre-a-Terre zu anderen Seite andeute, und
dann in den Galopp zu dieser Seite wechsele. Es geht voran! (S.a.
Update v. 21.09.23 )
Update 04.02.2024
Seitdem ich die schöne Supination der Gertenhand im Bild „Ausbildung des Reiters im Terre-a-Terre“ bei Simon Georg Winter (s. 2. Bild auf meiner Seite „Reitkunst“) bewusst wahrgenommen habe, hat sich mein Anspruch an die Gertenhaltung erhöht, in dem Sinne, dass nun in allen Reitsituationen, in denen es möglich ist die Supination den Vorrang bekommt.
Wenn ich also nun die Gerte parallel zum Pferdekopf halte, um ihn für Stellung und Biegung und zum Abwenden zur Gegenseite zu schieben, mache ich dies nun auf beiden Seiten immer mit einer supinierten, locker sehr geöffneten Gertenhand, genauso wie Gueriniére es dargestellt hat und kann jetzt meinen Oberkörper gleichmäßig in immer derselben Körperhaltung belassen: genauso muss damals der Reitmeister Regenthal auf Eisenberg gewirkt haben, als dieser bewundernd dessen Reitstil beschrieb mit den Worten: " Ich habe niemals einen Reiter gesehen, der steiffer zu Pferde gesessen wäre oder der die Vortheile sonderheitlich der Beine besser gewusst hätte als er! Es war eine rechte Freude anzusehen..!"

Seit über 10 Jahren hatte ich in diesen Bildern nur gesehen, dass die Gerte seitlich des Pferdehalses gehalten wurde, aber nicht registriert, WIE sie gehalten wird!

Während ich früher im FN-Reitunterricht (beidhändig auf Wassertrense) den Grund für die gelegentlich erfolgte Ermahnung: „Nicht mit verdeckten Händen reiten!“ ohne eine dazu passende Erklärung nicht verstanden und deshalb auch immer wieder mal vergessen/ignoriert hatte, wird mir jetzt noch mehr deutlich, wie wichtig sie ist, damit sich meine Schultern nicht einrollen, mein Oberkörper nicht nach vorn fällt, ich so nicht nach unten sehe und deshalb dem Pferd nicht auf der Vorhand liege/sitze und nicht mehr ständig gegen diesen verhaltenden Sitz an treiben muss.
Auch die Haltung meiner Zügelhand zum Schieben des Pferdehalses zur Zügelhandseite beim Abwenden habe ich geändert: seit dem Beginn des Herantastens an die einhändige Zügelführung hatte ich dabei intuitiv immer die Zügelhand proniert gehalten (verdeckte Hand). Inzwischen bemerke ich ein minimales Verhalten des Pferdes wenn ich so die Zügelhand proniere (was ich bisher immer allein auf die natürliche Abbremsung durch das Biegen zurückgeführt hatte und nicht auf das leichte Einrollen meiner Schulter dabei) und trainiere nun, auch bei der Wendung zur Zügelhandseite eine Supination der Zügelhand beizubehalten.
Das Primat der supinierten Hände, wie ich es nun nenne, sehe ich nun als Voraussetzung für die Perfektionierung des Reitersitzes an, welche wiederum die Voraussetzung ist für das Perfektionieren jeder Lektion ist: nicht umsonst bezeichneten ja die Alten den Sitz des Reiters als die wichtigste Hilfe überhaupt!

Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel: auf der Darstellung der Piaffe zeigt Gueriniére eine Mittelstellung zwischen maximal pronierter und maximal supinierter Handhaltung: zum Versammeln wird hier hier zusätzlich der Daumen gegen den Gertenschaft gedrückt.
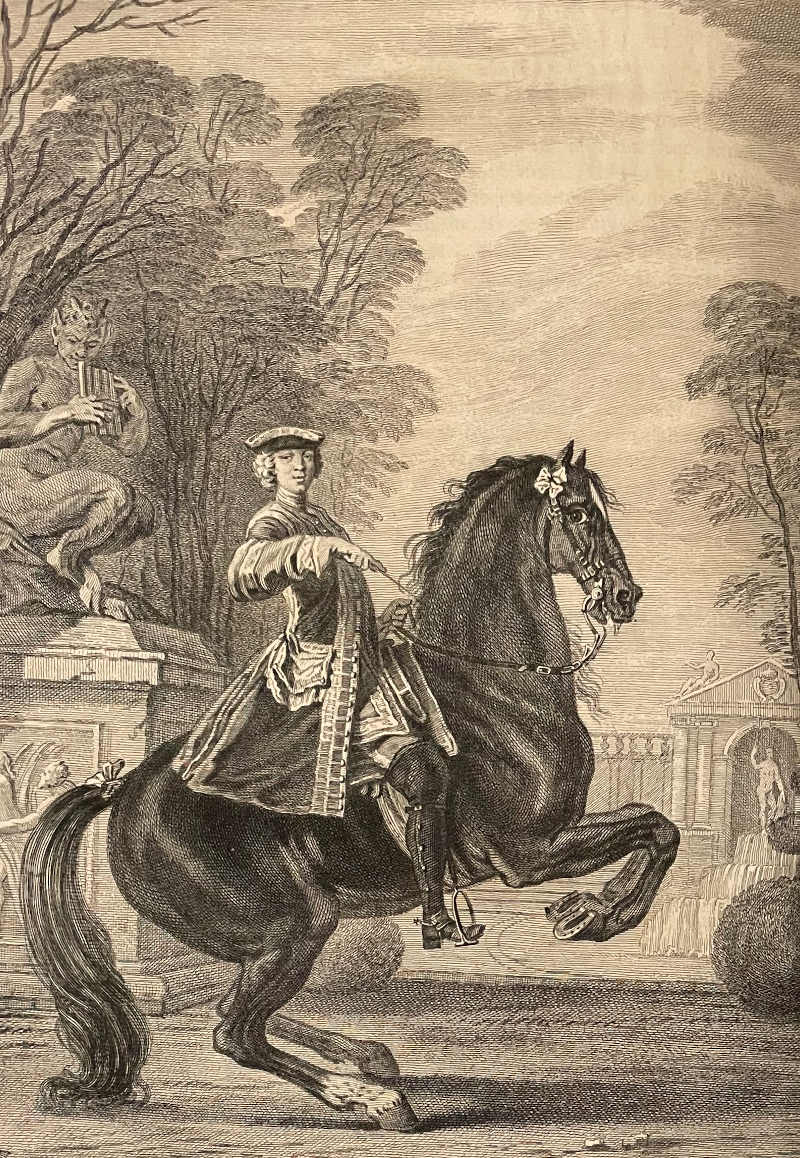
Auch falls sogar eine völlige Pronation erforderlich ist, tritt ebenso wie im obigen Beispiel, die übergeordnete Hauptregel ein: das Zurücknehmen der Schultergelenke und leichte Vorschieben des Reiter-Brustbeins, wie auf der Darstellung der Levade bei Gueriniére begleitet vom Kreuzen der Gerte/Gertenhand über den Pferdehals mit Zeigen der Gertenspitze zum Boden, wie es häufig zur Unterstützung von Schulparade und Levade benutzt wird: auch hierbei muss das gertenseitige Schultergelenk ganz bewusst deutlich zurückgehalten werden (was in dieser Darstellung unterstützt und erleichtert wird durch Anlegen des Zeigefingers an den Gertenschaft); dies erzeugt eine zu Anfang sehr ungewohnte Haltung.
Eine wunderbare Kontrolle des Reitersitzes ist die Frage: „Zeigt mein Bauchnabel wirklich nach vorn, mittig zwischen die Pferdeohren (bzw. äußerst minimal nach innen)?“. Hierbei wird häufig klar, dass man fehlerhaft den Bauch eingezogen hatte: schiebt man ihn dann vor, sozusagen „in die supinierten Hände“ , merkt man den drastischen Unterschied sofort!
In meiner bisherigen Forschung habe ich für mich inzwischen herausgefunden, was ich ganz sicher als Fehler in den alten Reitkunstlehrbüchern ansehe und nicht anwenden werde, hier
Meine persönliche Negativliste
Bei La Broue:
1. Die relativ lange und starke Benutzung des Kappzaums beim Reiten eines jungen, ungeschulten Pferdes (dies führt zum Ziehen an den Zügeln, sowohl beim Pferd, als auch beim Reiter, und ruiniert so den Reitersitz, beschwert die Vorhand des Pferdes und verdirbt so Reiter und Pferd: Abhilfe durch korrektes Reiten ist manchmal gar nicht mehr möglich, dauert aber zumindest sehr viele Monate oder Jahre. (Stattdessen nutze ich lieber vor dem ersten Aufsitzen eine monatelange Ausbildung vom Boden aus am mittleren Ring des Kappzaums).
Bei Cavendish schlecht oder ganz falsch:
1. Er lässt die Gerte mit dem dicken Ende an der Kleinfingerseite aus der Faust austreten (dies führt aber zu Verspannungen im Reiterrücken, die sich auf den Pferderücken übertragen).
2. Die Benutzung einer Kandare „á la Connestable“, die einfache Trensenkandare reicht ja vollkommen aus.
3. Reiten mit dem Pferdekopf zur Wand.,
4. Die auf den Kupferstichen dargestellten Überbiegungen und anderen Darstellungsfehler.
Bei Solleysels abgewandelter Cavendish-Übersetzung schlecht oder falsch:
1. Man könne/solle junge Pferde zunächst auf Wassertrense anreiten (auch dies führt zum Ziehen an den Zügeln, sowohl beim Pferd, als auch beim Reiter und ruiniert so den Reitersitz und beschwert die Vorhand des Pferdes und verdirbt Reiter und Pferd: Abhilfe durch korrektes Reiten ist manchmal gar nicht mehr möglich, dauert aber zumindest sehr viele Monate oder Jahre ),
2. Alle oben bei Cavendish aufgeführten Fehler.
Bei Gueriniére halte ich für schlecht oder ganz falsch:
1. Die Aussage, man könne/dürfe den Pferdekopf durch Ziehen am Kandarenzügel seitwärts ziehen,
2. Man dürfe/solle junge Pferde zunächst auf Wassertrense anreiten (s.o.).
Update 16.02.24
Wow, endlich eine Lösung für meine bei einhändiger Zügelführung links meist zu hoch stehende rechte Schulter: wenn ich die Gerte so wie oben bei Gueriniére im Galopp und im Croup-au-Mure quer über den Hals des Pferdes lege und dabei die tief stehende Gertenhand stark supiniert und geöffnet halte, tritt meine Schulter plötzlich tiefer, fast so als ob ein ausgekugeltes Gelenk wieder zurück schnappt! Ein ganz anderer, zwanglos gleichmäßiger Sitz entsteht! Das ist ein echter „Game-Changer“ für mich, fast ebenso bedeutsam wie der vom 15.Mai 2020! Jetzt erst ist mir klar geworden, dass Gueriniére uns mit diesen Bildern nicht hauptsächlich zeigen will, dass man den Pferdehals mit der seitwärts vom Pferdehals positionierten Gerte zur Gegenseite schieben kann, sondern vor allem, dass man durch diese Handhaltung einen viel besseren Reitersitz erzeugt!
Nun besitze ich folgende Eichinstrumente, mit denen ich meinen Reitersitz einstellen und in allen Situationen überprüfen und bei Bedarf korrigieren kann:
1. Das Geradeaus Sehen, möglichst in die Ferne und zwischen den Pferdeohren durch, zum Eichen meiner Kopfstellung, im Zusammenspiel mit dem geradeaus zeigenden Bauchnabel;
2. Das „Nichtverdecken der Hände“/ das Zeigen der Fingernägel Richtung Reiterbrust/ die Supination der Hände, gegen ein Einrollen der Schultern und ein Einziehen des Reiterbauches;
3. Das Zeigen die Fingermittelgelenke beider Hände zueinander, gegen ein Nachvornfallen des Reiteroberkörpers;
4. Die eher feste Anlehnung in den Steigbügeln, gegen einen Abbruch der Kraftlinie von meinen Füßen bis in meinen Kopf, anstelle fehlerhaft die Kniegelenke zu beugen;
5. Die verschiedenen Arten des Hüftstützes, um ein Zurückstehen der Gertenhandschulter zu verhindern;
6. die oben beschriebene maximale Gertenhandsupination, zur Verhinderung eines Hochstands der Gertenhandschulter.
Update 29.02./05.03.2024
Mit meinem heutigen Wissen muss ich mich nun immer innerlich zur Ordnung rufen, wenn ich wieder mal denke: „Oh, dieses Pferd würde ich gerne mal reiten!“, denn fast alle Pferde werden heute nicht auf Kandare geritten, die meisten anderen modernen Zäumungen aber würde meinen Sitz und mich wieder für Monate verderben, weil ich wieder zum Ziehen an den Zügeln käme (s. Update Mai 23).
Eine Ausnahme wären evtl. das Pelham, dass schon bei Gueriniére Beachtung fand, oder das Kimblewick: wenn man die oberen Zügellöcher frei lässt, und in die unteren schmalen glatte Kandarenzügel ohne Stege einschnallt, könnte man bei einhändiger Zügelführung dieselbe Einwirkungsweise wie bei einer Kandare erzielen: durch Anheben der Zügelhand eine Zunahme der Kinnkettenspannung erzeugen, wodurch das Pferd die Nase absenkt und sich versammelt, dagegen durch Anziehend der Zügel bei tief stehender Hand ein Vorwärts-Abwärts zum Zulegen erzeugen; ABER dagegen spricht, dass ein fremdes Pferd wohl auch an diesen Gebissen ziehen würde, und dass diese Gebisse viel zu scharf sind, weil sie bei weitem nicht die Dicke meiner jetzigen Trensenkandare haben, (sie dürften sowieso nur 1x gebrochen sein!), obendrein sind Pelham und Kimblewick durch die extrem kurzen „Unterbäume“ bei weitem nicht so komfortabel für das Pferd wie die langen Unterbäume, an die ich inzwischen seit Jahren gewöhnt bin…).
Überhaupt müsste ich mich obendrein ernsthaft nach dem Sinn fragen: die alten Bereiter wussten genau, dass sie ein Berittpferd nur wenig besser als ihr Auftraggeber reiten durften, d.h. sie mussten diese Pferde fast so schlecht reiten wie jene, denn wenn der Abstand im Können des Berittpferdes zum Können des Auftraggebers zu groß wird, sind schwere Konflikte vorprogrammiert. Am ehesten sinnvoll wäre ein Fremd-Beritt ohnehin nur, wenn der Auftraggeber begleitend ebenfalls beim Bereiter sehr häufigen Unterricht nimmt, damit er sich parallel zum Pferd entwickeln und sein Pferd verstehen lernen kann. Das unten stehende Bild zeigt, wie es sonst ablaufen könnte:

aus: "Überfall auf eine Reisegruppe", von Izaack van Osten; Flandern, 1650; Öl auf Holz, Museum Orléans
Dieser Räuber will das beim Überfall erbeutete Pferd weg reiten, das Pferd kann ihn aber nicht verstehen, da es hoch ausgebildet und wahrscheinlich auf einen einzigen Reiter ausgerichtet ist.
Update 21.03.24
Weil Picasso gelegentlich vorgeworfen wird, er spiele viel zu viel mit dem Gebiss, was ihm die Konzentration auf die Reiterhilfen einschränke, und weil dem TA immer wieder auffällt, wie empfindlich er an seinen vorderen Backenzähnen reagiert, habe ich nach dem obigen Eintrag beim Recherchieren von Pelhams eins mit einem Gummi-überzogenen Mundstück gefunden und zum Ausprobieren bestellt: es ist eins mit einem relativ dicken Mundstück und mit etwas längeren Unterbäumen.
Das Ergebnis ist enttäuschend: die Pferde gehen damit mit weit erhobener Nase und auf der Vorhand; ein Anheben des Zügelarmes führt nicht zu einer Absenkung der Nase/Anheben des Genicks, im Gegenteil! Bin schon jahrelang nicht mehr englisch geritten, trotzdem gingen ohne eine richtige Kandare die Pferde sofort wieder so, als hätten sie nie eine Reitkunstausbildung erhalten!
Also würde ich auf einem fremden Pferd nun doch nur sitzen wollen, falls es eine richtige Kandare trägt, alles Andere ruinierte ja meinen Sitz, weil ich wieder zum Ziehen an den Zügeln käme.
Update Ostern 2024
Vor vier Wochen kam die Frage auf, ob bei der alten Kunstreiterhandhaltung so, wie beim FN-Reitunterricht gefordert, die Zügelhand im Handgelenk die Neutral-Null-Handhaltung eingehalten werden sollte, also weder Streckung noch Beugung im Handgelenk, sodass Handrücken und Unterarm eine gerade Linie bilden.
Nachdem ich dies drei Wochen lang ausprobiert hatte wurde mir klar: das geht so nicht! Seit einer Woche nun habe ich das Gegenteil ausprobiert: eine deutliche, manchmal gar maximale Überstreckung (= Abknickung des Handgelenkes handrückenwärts) und siehe da, das passt gut!
Nun ist meine Reihenfolge beim Einstellen der Hände folgendermaßen: zunächst richte ich die Fingermittelgelenke der Zügelhand so aus, dass sie wie Pfeilspitzen 90° quer zum Pferdekörper zeigen, also im rechten Winkel, dann kippe ich sie so, dass die Fingernägel der Zügelhand auf meine Brust zeigen (eher hoch als tief), und dann überstrecke ich die Zügelhand mehr oder weniger stark.
Dann folgt die Gertenhand, zunächst quer über den Mähnenkamm kreuzend, maximal supiniert und auch mehr oder weniger überstreckt; manchmal auch den Gertenarm lang herunter hängend, das Gertenende wie immer in der Handfläche endend, auch hierbei sehr supiniert, und neuerdings auch die Gertenhand mehr oder weniger überstreckt im Handgelenk. Dadurch kommt der Reiterbauch leicht und mühelos vermehrt nach vorn, und der Gertenhandoberarm etwas mehr zur Seite weg vom Reiteroberkörper ab, sodass der Reiterkörper freier zwischen seinen Armen durch schwingen kann und locker wird.

"August der Starke zu Pferde" (in der Falkade), Paul Heermann, 1711, Museum Dresden
Genau so halte ich jetzt meine Zügelhand!
In diesen Wochen feiere ich übrigens ein 1.000er Jubiläum, weil ich jetzt seit 8 Jahren den alten Kunstreitersitz mit eher nach vorn gehaltenen Beinen und deutlicher Anlehnung in den Steigbügeln benutze, denn die im prekären Englischsitz mehrfach pro Woche auftretenden, mehr oder weniger starken Hodenprellungen/-quetschungen beim plötzlichen Stocken oder Zurseitespringen des Pferdes sind nicht ein einziges Mal mehr aufgetreten! Das finde ich immer noch total erstaunlich und unglaublich! Acht Jahre x 50 Wochen x zwei bis drei dieser unangenehmen Ereignisse ergeben 800-1.200 Mal! Wahrscheinlich würden sehr viel mehr Männer beim Reitsport bleiben, wenn sie diese Unannehmlichkeit durch den alten Kunstreitersitz ebenfalls komplett vermeiden könnten?!
NACHTRAG: Wichtig ist, zum Treiben hinter dem Gurt das ganze Bein gestreckt nach hinten zu nehmen und die Anlehnung an die Bügelplatte unverändert beizubehalten, und nicht allein den Unterschenkel nach hinten zu führen!
Des Kunstreiters Freud' ist des Englischreiters Leid (eine ungewollte Schulparade): wohl kaum eine Darstellung charakterisert so gut die Gegensätze dieser beiden Reitweisen:
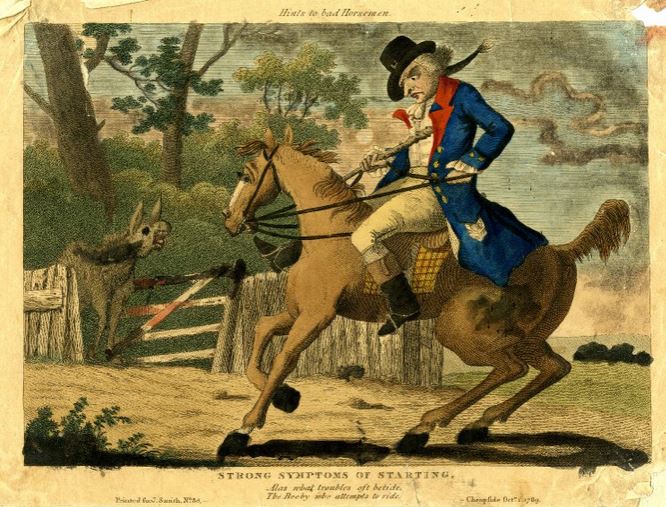
Mit freundlicher Genemigung des British Museum BM
Update 23.04.2024
Auch hier die Handhaltung, die ich nun benutze, dargestellt bei dem Escuyer, der die Lanze des Chefs dieser Quadrille, Prinz Condé, trägt, beim großen Pferde-Caroussel Ludwigs des 14., welches er 1662 gab zum 1. Geburtstag seines Sohnes.
„Türkischer Page, Kostümjacke aus blauem Samt, silberbesetzt, mit Bordüren aus schwarzem Samt mit Gold. Seine Pferdedecke ebenso, mit Halbmonden aus Silber.“
Aus: „Courses de Testes de la Bague, faites par le Roy en l’année 1662“, Verlag Gallimard; Stich von Francois Chaveau nach einer Vorlage von Henri Gissey. ca. 1665.
|
|